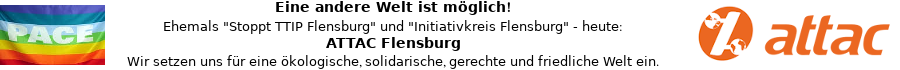Zum Niedergang der Weltmacht USA hat auch Deutsch-Europa beigetragen.
Es scheint eine jener ironischen Wendungen zu sein, zu denen der Weltgeist besonders in Krisenzeiten aufgelegt ist: Ausgerechnet der megalomane Borderliner Donald Trump, der antrat, die USA »wieder groß zu machen«, darf nun ihrer Abwicklung als globale Hegemonialmacht präsidieren. Die Vereinigten Staaten könnten »nicht weiterhin der Weltpolizist sein«, erklärte Trump Ende Dezember letzten Jahres während eines überraschenden Besuchs bei amerikanischen Soldaten im Irak. Es sei nicht fair, wenn das US-Militär die Last des Weltordnens allein tragen würde: »Wir möchten nicht mehr von Ländern ausgenutzt werden, die uns und unser unglaubliches Militär nutzen, um sich zu schützen.« Gewisse Länder würden »nichts dafür zahlen« wollen, so der Präsident mit dem Hinweis auf Auseinandersetzungen zwischen Washington und insbesondere Berlin um Militärausgaben und Nato-Beiträge. Die US-Army sei »auf der ganzen Welt verteilt«, was Trump »ehrlich gesagt lächerlich« findet.
Trumps Truppenbesuch und sein Herumtrampeln auf der Dienstmarke des Weltpolizisten am zweiten Weihnachtsfeiertag auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Asad in der westirakischen Provinz Anbar waren eine Reaktion auf die heftige Kritik, die dem zunehmend erratisch agierenden Präsidenten in Washington entgegenschlägt, seit er sich überraschend zum Truppenabzug aus Syrien entschlossen hat. Die Entscheidung zum Abzug habe Trump eigenmächtig »gegen Einwände nahezu aller Beteiligten« während eines Gesprächs mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan getroffen, meldeten US-Nachrichtenagenturen unter Verweis auf Stellungnahmen aus dem Umfeld des Präsidenten – und sie löste die Rücktritte des Verteidigungsministers James Mattis und des Sonderbeauftragten für den Kampf gegen den IS, Brett McGurk, aus. Man habe Trump vor dem Telefonat mit Erdoğan mit entsprechenden Informationen und Argumenten versorgt, die er früher beherzigt habe, um den türkischen Machthaber von einer Invasion Nordsyriens abzuhalten. Der US-Präsident habe sich diesmal aber während des Gesprächs die Argumentation Erdoğans zu eigen gemacht. In den folgenden Tagen bemühten sich seine Berater, ihn zumindest zu einer Verzögerung des Truppenabzugs zu bewegen.
Oberflächlich betrachtet scheint Trump die etablierte Geopolitik der USA zu torpedieren. Auf den zweiten Blick aber wird deutlich, dass der Präsident und das geopolitische Establishment in der Syrien-Frage gar nicht weit voneinander entfernt liegen. Die »Washington Post« bemerkte am 27. Dezember, dass der Rückzug »im Kern korrekt« sei. Das US-Portal »Foreign Policy« präzisierte, dass Trump – »wie üblich« – auf die falsche Art das Richtige machen würde. In Syrien sei angesichts der Verwüstungen im Land nicht mehr viel zu gewinnen, der Kriegsschauplatz dürfte sich zu einem »kostspieligen Sumpf« für »Russland, Iran, Hisbollah, Türkei und sonstige Akteure« entwickeln.
Das strategische Interesse der USA bestehe schließlich vorrangig darin, den Öl- und Gasexport aus der Region zu gewährleisten. Dies könne aber auch dadurch erreicht werden, dass die USA dabei helfen, »zu verhindern, dass ein Staat die gesamte Region unter Kontrolle bringt«.
Der Rückzug aus Syrien kann als Anzeichen für das faktische Ende der US-Hegemonie interpretiert werden. Vor gut 15 Jahren hatte Washington den Irak-Krieg mit der ausdrücklichen Zielsetzung entfacht, den Mittleren Osten politisch und sozioökonomisch entlang der Interessen der westlichen Zentren des Weltsystems umzuformen. Heute ist man in Washington bloß noch froh darüber, anderen Mächten solche Machtoptionen verweigern zu können. Außerdem wollen sich die USA auf die chinesische Herausforderung konzentrieren.
Zur Erosion der Machtbasis der USA hatauch die immer deutlichere Herausforderung der Vereinigten Staaten durch Deutsch-Europa beigetragen. Den Westen als einen mehr oder minder geschlossenen Staatenverbund unter der Führung der USA gibt es heute längst nicht mehr. Berlin hat maßgeblich zum Scheitern Washingtons im Nahen und Mittleren Osten beigetragen – vor allem durch die umfassende ökonomische Stützung des türkischen Regimes. Washington mag noch seine Stützpunkte in der Bundesrepublik nutzen können, deutsches Kapital arbeitet aber bereits völlig offen an der Untermnierung amerikanischer Machtmittel.
Das wurde im August 2018 evident, als Washington die in der Türkei schwelende Schulden- und Wirtschaftskrise nutzte, um Ankara mit ökonomischem Druck zur Räson zu bringen. Während die türkische Lira rapide an Wert verlor und die Inflation imLand beständig zunahm, konnte Trump mit einer per Twitter angekündigten Erhöhung der US-Strafzölle gegen Ankara Mitte August die türkische Krise eskalieren lassen. Zu diesem Zeitpunkt schienen die US-Machtmittel noch intakt, was auch die Durchsetzung von abermaligen Sanktionen gegen den Iranzeigte, die auch von deutschen Konzernen weitgehend befolgt werden mussten.
Doch nur wenige Monate später konnte Ankara die türkische Wirtschaft zumindest vorübergehend stabilisieren und mittels der Drohung mit einer militärischen Konfrontation in Nordsyrien Trump zum Einlenken bringen. Neben Katar, das dem ökonomisch bedrängten türkischen Regime mit Investitionen von 15 Milliarden US-Dollar beistand, und China, das Investitionen von rund 3,6 Milliarden Dollar ankündigte, war der Beitrag der BRD entscheidend. Auf rund 35 Milliarden Euro soll sich der Deal zur umfassenden Modernisierung des türkischen Schienennetzes belaufen, auf den sich Berlin und Ankara im vergangenen September verständigt haben. Diese massiven Investitionen, die an die deutsch-osmanische Bagdad-Bahn erinnern, fungieren de facto als klassisches keynesianisches Konjunkturprogramm für das Erdoğan-Regime, das die Konfrontation mit den USA dank dieser Hilfe überstehen konnte. Berlin verfolgte in der Region einen indirekten Konfrontationskurs gegenüber Washington – und war damit erfolgreich.
Nicht nur wirtschaftlich, auch militärisch will Deutschland – in diesem Fall gemeinsam mit Paris – Deutsch-Europa als Konkurrenten der USA etablieren. Schon beim letzten seiner berüchtigten Europa-Besuche Anfang November machte Trump die zunehmenden Differenzen innerhalb der Nato öffentlich, indem er sich via Twitter vehement gegen die Idee einer eigenständigen europäischen Militärmacht aussprach, die vor allem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron propagiert. Die Europäer sollten besser »ihren fairen Anteil an der Nato« zahlen, die von Washington »subventioniert« würde, polterte Trump am 9. November kurz vor dem Treffen in Paris.
Anschließend ließ er eine geplante Zeremonie zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg ausfallen. Am 13. November provozierte Angela Merkel Washington mit der Aussage, den französischen Vorschlag zum Aufbau einer EU-Interventionsarmee zu unterstützen. Außerdem kündigte die Bundeskanzlerin in ihrer Neujahrsansprache ein stärkeres internationales Engagement der Bundesrepublik an und der Generalinspekteur der Bundeswehr versprach Ende Dezember, die Möglichkeiten einer raschen Anwerbung von EU-Ausländern für die Bundeswehr auszuloten, um dem zunehmenden »Fachkräftemangel« zu begegnen. – Kein Wunder also, dass Trump Anfang Januar in einer Rede zeterte: »Europa ist mir egal« und: »Wenn ich in Europa beliebt wäre, würde ich keinen guten Job machen.«
Das zentrale Feld der Auseinandersetzung zwischen Deutsch-Europa und den USA ist aber die Handels- und Währungspolitik. Die Iran-Sanktionen Trumps dienten letztlich Berlin und Brüssel als Vorwand für die offene Herausforderung der Rolle des US-Dollars als Weltleitwährung. Während die EU-Kommission Anfang Dezember ankündigte, mit einer »Reihe von Schritten« das Gewicht des Euro im »internationalen Zahlungsverkehr und als Reservewährung« gegenüber dem US-Dollar zu erhöhen, lamentierten das »Handelsblatt« und die »Süddeutsche Zeitung« über den Missbrauch des Dollar als »Druckmittel« und »politische Waffe«. Zuvor hatte bereits Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in einer Rede gefordert, der Euro müsse das »Gesicht und das Werkzeug« einer neuen »europäischen Souveränität« werden.
Brüssel will vor allem die Energieimporte der EU im Wert von 300 Milliarden Euro pro Jahr, die zu 80 Prozent immer noch in Dollar abgewickelt werden, zunehmend auf Euro umstellen sowie Konzerne wie den deutsch-französischen Flugzeugbauer Airbus dazu bewegen, ihre Geschäfte in Euro abzuwickeln. Hinzu kommen Initiativen der EU-Kommission zum Aufbau eines unabhängigen europäischen Zahlungssystems, das in Konkurrenz zu internationalen Zahlungsdienstleistern wie Visacard, Mastercard oder Paypal treten soll.
Laut Währungskommissar Pierre Moscovici gehe es Brüssel bei den geldpolitischen Abkopplungsbemühungen gegenüber Washington aber darum, »die europäischen Bürger und Unternehmen besser vor externen Schocks zu schützen und die Widerstandsfähigkeit des internationalen Währungs- und Finanzsystems zu erhöhen«. Konkret bedeutet dies, dass die Europäer eine ähnliche Stellung wie die Vereinigten Staaten anstreben, die sich problemlos in ihrer eigenen Währung verschulden können, ohne »zusätzliche Risiken«, etwa durch Wechselkursschwankungen, einzugehen. Solche Spielräume will nun auch die fragile Euro-Zone – gerade in Hinblick auf drohende abermalige Krisenschübe – gewinnen.
Darüber hinaus will Brüssel denjenigen afrikanischen Staaten »technische Hilfe« gewähren, die den Euro als internationale Währung benutzen wollen. Diese Ankündigung der EU, den hochverschuldeten USA die Stellung des US-Dollar als globale Leitwährung streitig zu machen, ist eine Reaktion auf die Drohungen Trumps, die vom US-Markt abhängige deutsche Exportwirtschaft mit hohen Zöllen zu belegen. Noch Anfang Dezember haben sich deutsche Automanager zu einem Gespräch im Weißen Haus einfinden müssen, um die Trump-Administration von etwaigen protektionistischen Schritten gegen ihre Branche abzuhalten.
In den Auseinandersetzungen der Staatsapparate beiderseits des Atlantiks spiegelt sich – wie auch im Handelskrieg zwischen China und den USA – der objektive, sich hinter den Rücken der geopolitischen Subjekte entfaltende historische Krisenprozess. Die Eskalation der Handelskonflikte, bei denen alle Beteiligten sich bemühen, mit ihrer Überschussproduktion auch Arbeitslosigkeit und Schulden zu exportieren, ist ebenso Produkt der systemischen Überproduktionskrise, in der sich das gesamte Weltsystem befindet, wie die dekadenlange Verschuldung der USA in ihrer Weltleitwährung, deren Position Berlin und Brüssel nun erklärtermaßen angreifen.
Vor dem Hintergrund des sich in Schüben entfaltenden Krisenprozesses lohnt ein Blick auf das ökonomische Fundament der US-Hegemonie in den vergangenen drei Jahrzehnten. Weshalb wurde die Hegemonie Washingtons in den Jahrzehnten nach dem Zusammenbruch des realexistierenden Sozialismus akzeptiert oder zumindest toleriert?
Es war offensichtlich das gigantische Handelsdefizit der Vereinigten Staaten, das Ländern wie der Bundesrepublik oder auch China einen handfesten ökonomischen Grund lieferte, den Status quo hinzunehmen: Die sich deindustrialisierenden USA konnten sich in Dollar, als dem globalen Wertmaß aller Dinge, verschulden, ihre konsumgetriebene Defizitkonjunktur aufrechterhalten und exportorientierten Ländern und Regionen wie China oder der BRD einen Absatzmarkt für ihre Überschussproduktion verschaffen. Die sozioökonomischen Folgen der Deindustrialisierung in den Rust Belts der USA spülten schließlich Trump ins Weiße Haus, der mit seinem protektionistischen Programm der »Reindustrialisierung« der USA die Globalisierung in den Kollaps zu treiben droht.
Aber auch Trump vollzieht dabei nur eine objektive irrationale Krisentendenz nach: Der Prozess der Globalisierung fußt auf einer permanent steigenden Verschuldung, die maßgeblich durch die Aufblähung der Finanzmärkte angetrieben wird. Dieser Prozess des ständigen Hinausschiebens des manifesten Ausbruchs der Überproduktionskrise scheint nun an sein Ende gelangt zu sein. Was sich perspektivisch abzeichnet, ist der Einsturz dieses ökonomischen Kartenhauses samt eines Versagens der globalen Handels- und Defizitkreisläufe und der Übergang in eine neue Phase autoritärer und nationalistischer Krisenverwaltung.
Die Rolle des Weltpolizisten ist unter diesen Bedingungen nicht mehr sonderlich attraktiv. Der Imperialismus zeigt in der Weltkrise des Kapitals ein anderes Gesicht: Es ist der Kampf aller gegen alle wider den eigenen Abstieg. Das expansive Moment des Imperialismus kippt zunehmend in die Abschottung. Am Ende des Westens steht nicht dessen Ablösung durch ein anderes kapitalistisches Hegemonialsystem – etwa mit dem staatskapitalistischen China im Zentrum –, sondern die Erosion der ökonomischen Basis globalen Dominanzstrebens als solcher. Historische Parallelen lassen sich zum Zusammenbruch der staatskapitalistischen Sowjetunion ziehen, der mit den entsprechenden Konkurrenzkämpfen innerhalb der postsowjetischen Zerfallsprodukte einherging.
Geschrieben am Mittwoch, 13. März 2019
Ein Freund schrieb mir einen Neujahrsgruss mitsamt einem absolut bemerkenswerten Link zu einem Gespräch mit einem Potsdamer Klimaforscher - mit seiner Eindringlichkeit war es für mich absolut überzeugend, daher gebe ich es euch z.K.:
Hi - ein kleiner Neujahrsgruss:
Ein Blick von 2018 auf das kommende Jahr - cool und lässig war natürlich der unteilbare, antirassistische Tanz der 240.000 Menschen über die Leipziger Straße in Berlin.
Aber:
War das schon unser ganzer Kampf für eine bessere Gesellschaft...?
Was einigen Freund*innen und mir seit April 2018 schwer im Magen liegt und auf der Seele brennt,
ist ein Thema, das einfach nicht so lässig zu haben sein wird:
Ich meine natürlich, die globale Erwärmung, gerne auch, halb verschleiernd, Klimawandel genannt - bitte schaut in dieses Interview rein, nehmt euch die Zeit:
Es ist deutlich geworden, dass ganz offenbar keiner und keine so recht Bock hat, sich der wichtigsten Aufgabe vor der wir stehen zu zuwenden und hier vom Reden zum Handeln zu kommen...
In den nächsten Jahren wird sich zeigen müssen, wozu wir willens und fähig sind ....
Beste Grüsse ....
____________________________________________________________________________________
Zur Info:
Stefan Rahmstorf: Der unterschätzte Klimawandel: Jetstreams, versinkende Städte, Todeszonen im Meer
Prof. Stefan Rahmstorf im Interview mit Fabian Scheidler (Kontext TV). Rahmstorf ist Co-Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und Professor für die Physik der Ozeane an der Universität Potsdam.
Klimamodelle haben einige wichtige Aspekte des Klimawandels bisher unterschätzt, so der weltweit renommierte Klimaforscher Stefan Rahmstorf.
Arktis und Antarktis schmelzen deutlich schneller als bisher angenommen.
Bereits bei einen Meeresspiegelanstieg von unter einem Meter seien Küstenstädte wie New York durch eine Zunahme von Sturmfluten existentiell gefährdet.
Die Veränderung von Luftströmungen wie dem Jetstream führe zu vermehrten Extremwetterereignissen wie Hitzewellen, Kälteeinbrüchen und Starkregen, auch in Europa.
Da 50 Jahre auf die Klimawissenschaften nicht angemessen reagiert wurde, sei nun ein sehr schneller Ausstieg aus den fossilen Energien notwendig.
Doch bei der Bundesregierung sei dazu der politische Wille nicht erkennbar.
Die enorm hohen Subventionen für Öl, Gas und Kohle müssen rasch abgebaut und neue Kohlekraftwerke weltweit verhindert werden.
Auch eine Reduktion des Flugverkehrs sei geboten.
31.08.2018, OXI
Die Bundesregierung versucht weiter, die Herausforderungen der Länder des globalen Südens von außen zu lösen und setzt dazu unbeirrt auf die neoliberale »Medizin« freier Märkte und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Das muss sich ändern.
»Fluchtursachen überwinden« ist zu einem Credo der deutschen Politik geworden. Auch im sogenannten »Masterplan Migration« von Bundesinnenminister Horst Seehofer taucht der Begriff auf. Um die Perspektivlosigkeit in weiten Teilen Afrikas zu überwinden, müssen jährlich mindestens 20 Millionen Arbeitsplätze neu geschaffen werden, schreibt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Hat es die richtigen Rezepte dafür?
Die Entwicklungspolitik ist ein herausforderndes Politikfeld. Sie darf nicht einseitig als Sozialpolitik für die Länder des globalen Südens betrachtet werden. Vielmehr müssen Politikfelder wie beispielsweise die Handelspolitik und die globale Finanz- und Steuerarchitektur stets mitgedacht werden. Zentraler Bestandteil der deutschen Entwicklungspolitik sollte es sein, die Ursachen von ausbleibender sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung überwinden zu helfen. Sie sollte den Partnern im globalen Süden die politischen Handlungsspielräume dazu geben anstatt von außen an Symptomen herumzudoktern.
Der Afrikaplan von Entwicklungsminister Gerd Müller – der Marshallplan mit Afrika – erkennt diese Herausforderung nach größerer entwicklungspolitischer Kohärenz stellenweise an. Doch der vermeintlich große Wurf scheint erneut zu einem Papiertiger zu werden. Von einem Paradigmenwechsel ist die deutsche Entwicklungspolitik noch immer weit entfernt.
Zentrale Herausforderungen afrikanischer Staaten
So unterschiedlich die Länder des globalen Südens sind, sie teilen einige zentrale Herausforderungen. In den meisten Ländern besteht eine hohe Unterbeschäftigung und Jugendarbeitslosigkeit. 84 Prozent der arbeitenden Bevölkerung in Afrika sind im informellen Sektor aktiv, das heißt beispielsweise als Straßenhändler, Tagelöhner und Kleinbauern. Es mangelt an formalen Arbeitsverhältnissen, die ein sicheres Einkommen ermöglichen würden. Die Wirtschaftsstruktur der afrikanischen Staaten ist überwiegend durch landwirtschaftliche Kleinbetriebe und den Rohstoffsektor bestimmt. Der industrielle Sektor ist unterentwickelt.
Dementsprechend gibt es auch kaum Wirtschaftsakteure, die besteuert werden könnten. Ein Problem, dass durch die Steuerflucht im Rohstoffsektor noch verstärkt wird (hier). Derzeit finanzieren sich viele afrikanische Staaten noch immer durch externe Quellen. Sei es durch bi- und multilaterale Entwicklungshilfe oder durch eine Auslandsverschuldung am Kapitalmarkt. Die aufgenommenen Schulden werden häufig nicht in die Diversifizierung der Wirtschaft investiert (Gründe siehe unten). Bei Weltmarktschocks wie dem Verfall von Rohstoffpreisen, drohen die Schulden nicht tragfähig zu werden. Es kommt wiederholt zu Schuldenkrisen.
Die deutsche Entwicklungspolitik tut zu wenig, um ein internationales Umfeld zu schaffen, innerhalb dem die Länder des globalen Südens diese Herausforderungen überwinden können.
Freihandelsdogma dominiert
In der Handelspolitik besteht Deutschland auf dem Abschluss von Freihandelsabkommen mit den afrikanischen Staaten (Wirtschaftspartnerschaftsabkommen – EPAs). Afrikanische Staaten sollen ihre Märkte öffnen, erlangen aber kaum Vorteile, da sie theoretisch meist schon freien Zugang zum EU Markt haben (hier). Durch die Marktöffnung drohen afrikanische Unternehmen und Kleinbauern durch Importe noch weiter marginalisiert zu werden. Denn afrikanische Staaten sind Studien zufolge nur bei 15 – 35 Prozent aller Produkte wettbewerbsfähig genug, um auf dem Weltmarkt bestehen zu können.
Das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE) fordert in einem von Entwicklungsminister Müller angefragten Papier, dass es den afrikanischen Staaten möglich sein müsse, »Teile der eigenen Wirtschaft vorübergehend vor dem übermächtigen internationalem Wettbewerb zu schützen« (hier). Damit würden die afrikanischen Staaten keinen Sonderweg einschlagen, sondern sich ein Beispiel an den erfolgreichen Industrialisierungsprozessen in den USA, Deutschland, Japan, Südkorea oder jüngst China nehmen. Alle diese Staaten konnten erst einheimische Industrien aufbauen, bevor sie ihre Wirtschaft für den Weltmarkt geöffnet haben.
Die EPAs zementieren hingegen das Freihandelssystem, welches mit der Schaffung der Welthandelsorganisation (WTO) institutionalisiert wurde. Und sie gehen über WTO-Bestimmungen hinaus. So schränken die EPAs beispielsweise industriepolitische Maßnahmen wie Exportsteuern und Bedingungen für ausländische Investitionen zur Förderung der einheimischen Wertschöpfung (local content clauses) weiter ein (hier).
Dabei gibt es Alternativen. Statt der Freihandelspolitik sollte Europa die regionale Integration Afrikas, also den Aufbau regionaler Märkte, unterstützen. Daneben könnten Beratungsleistungen – wie das vom DIE vorgeschlagene »Zukunftsprogramm afrikanischer Strukturwandel« – angeboten werden, damit afrikanische Industrien von handelspolitischen Schutzmaßnahmen profitieren anstatt dass diese auf politisch gut vernetzte »Unternehmer« zugeschnitten werden (hier mehr Details). Spannend ist, dass selbst Vertreter deutscher Wirtschaftsverbände auf ihren privaten Twitteraccounts schreiben, dass es eine starke afrikanische Wirtschaft brauche, da ohne lokale Partner und Kunden kaum von außen investiert werde.
Entwicklungsfinanzierung
Auch bei der Entwicklungsfinanzierung greift die Diskussion in Deutschland häufig viel zu kurz. Meist wird das Ziel in den Vordergrund gerückt, 0,7 Prozent des deutschen Bruttonationaleinkommens für die Entwicklungszusammenarbeit aufzuwenden. Während dieses Ziel löblich ist, verringert es nicht die Abhängigkeit Afrikas von externen Mittelgebern. Weitaus nachhaltiger wäre es, den illegalen Abfluss von Finanzmitteln und die Ausbeutung afrikanischer Reichtümer zu beenden. So verlieren die afrikanischen Staaten jährlich eine geschätzte Summe zwischen 30 und 100 Milliarden Euro an potenziellen Staatseinnahmen infolge von Steuerflucht zumeist multinationaler Konzerne. Hinzu kommen Abflüsse durch die Ausbeutung afrikanischer Fischbestände oder für den Schuldendienst infolge verantwortungsloser Kredite, die mitunter von korrupten Staatschefs aufgenommen wurden (hier).
Zusätzlich zu alljährlichen Versprechungen (Regierung) und Forderungen (Opposition) der Erhöhung der ODA-Quote (= Anteil der öffentlichen Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit am Bruttonationaleinkommen, BNE) sollte sich die Politik ehrlich machen und helfen, den Abfluss illegaler Finanzströme einzudämmen. Auf internationaler Ebene dürfte Deutschland nicht mehr bei der Bekämpfung der Steuerflucht bremsen (hier). Vielmehr sollte sich die deutsche Politik für eine Einbeziehung der Länder des Südens im Kampf gegen die Steuerflucht – also einer Verlagerung dieses Themas von der OECD hin zu UN – einsetzen. Auf nationaler Ebene könnte Deutschland endlich anfangen, auch afrikanische Länder am Informationsaustausch über Steuerdaten teilhaben zu lassen, statt die Steuerbehörden Afrikas weiter im Dunkeln tappen zu lassen und es Steuerflüchtlingen noch leichter zu machen (hier).
Marktgläubigkeit statt Anerkennung des Entwicklungsstaates
Obwohl der »Marshallplan mit Afrika«, der zentrale Entwicklungsplan von Entwicklungsminister Müller, einige progressive Passagen enthält, ist die deutsche Entwicklungspolitik noch immer zu marktbasiert ausgerichtet. Der vom damaligen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ins Leben gerufene »G20 Compact with Africa« fußt darauf, die Rahmenbedingungen für private Investitionen in Afrika zu verbessern. Afrikanische Staaten mussten sich beim G20-Treffen in Hamburg wie in einer Casting-Show mit ihren geplanten Reformbemühungen zur Verbesserung des Investitionsklimas bei Investoren und Partnerländern aus dem globalen Norden bewerben.
Ähnlich wie in der Wirtschaftspolitik für Europa, steht beim Compact die Wettbewerbsfähigkeit afrikanischer Staaten im Vordergrund. Durch beispielsweise schlanke Regulierungen, ein investitionsfreundliches Steuersystem, makroökonomische Stabilität, Investitionsschutz und Garantien zur Verringerung von Investitionsrisiken sollen ausländische Investoren nach Afrika gelockt werden (hier Details).
Der Fokus auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Investitionsbedingungen beißt sich selbst in den Schwanz. Denn ein Land, welches seine Investitionsbedingungen verbessert, lockt nur so lange Unternehmen an, bis ein anderes Land noch bessere Investitionsbedingungen aufweisen kann. Es besteht also die Gefahr, dass die afrikanischen Staaten miteinander um die kargen Investitionen ausländischer Unternehmen konkurrieren, dass sich also mittelfristig Kosten und Ertrag nicht mehr die Waage halten. Es zeigt sich, wie wichtig es ist, die einheimische Wirtschaft zu fördern. Lokale Unternehmen haben ein genuines Interesse an der Entwicklung ihres Landes und sind dort viel stärker verwurzelt. Im Gegensatz zu internationalen Firmen werden sie ihr Land nicht verlassen, wenn es in einem Nachbarland vermeintlich bessere Investitionsbedingungen gibt.
Die deutsche Entwicklungspolitik muss sich endlich vom neoliberalen Dogma freier Märkte und des schlanken Staates lösen. Die Entwicklungserfolge der asiatischen Tigerstaaten und später Chinas zeigen die Bedeutung eines starken Staates, denn sie beruhten nicht auf freien Marktkräften. Der Schutz für einheimische Produzenten, die Bereitstellung von Krediten für produktive Unternehmen und strategisch wichtige Industriesektoren, die Förderung der Ausbildung und später von Innovationen und technologischem Fortschritt waren essentielle staatliche Leistungen, ohne die den asiatischen Staaten kein so erfolgreicher Aufholprozess gelungen wäre (hier).
Fazit
Abschließend ist festzuhalten, dass die deutsche Entwicklungspolitik nicht im leeren Raum stattfindet. Sie wird von deutschen Wirtschaftsinteressen und wirtschaftspolitischen Überzeugungen beeinflusst. So ist Deutschland mit seinem exportlastigen Wirtschaftsmodell vom freien Zugang zu Exportmärkten abhängig. In Regierungskreisen wird wahrscheinlich befürchtet, dass protektionistische Maßnahmen wieder an Attraktivität gewinnen könnten, wenn sie Entwicklungsländern erlaubt wären. Befürchtet wird scheinbar, dass sich auch größere Handelspartner dieser Maßnahmen bedienen und Deutschland Exportmärkte verlieren würde.
Zudem setzt Deutschland sowohl im Inland als auch bei europäischen »Krisenländern« komplett auf die Verbesserung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit, also auf ein neoliberales Wirtschaftsmodell, in dem Staaten wie Unternehmen angesehen werden und es hauptsächlich um die Senkung von Kosten geht. Diese wirtschaftspolitischen Überzeugungen werden sich letztendlich immer auf die Entwicklungspolitik übertragen. Dementsprechend ist nicht absehbar, dass Deutschland sich in der Entwicklungspolitik für eine stärkere Rolle des Staates oder eine Abkehr vom Dogma der Wettbewerbsfähigkeit einsetzen wird.
Das deutsche Wirtschaftsmodell steht somit einem Paradigmenwechsel in der Entwicklungspolitik im Weg. Deutschland wird weiter versuchen, die Herausforderungen der Länder des globalen Südens von außen zu lösen und dazu weiter die neoliberale »Medizin« freier Märkte und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit verschreiben. Der Aufbau oder vielmehr die Rekonstruktion eines Weltwirtschaftssystems, in dem wirtschaftlich schwächere Länder politisch ausreichend Handlungsspielräume haben, um eigene Entwicklungspfade zu bestreiten – wie es Südkorea, Taiwan und Co. in den 1960er und 1970er Jahren taten (hier) – wird somit auch von Deutschland verbaut.
Nico Beckert beschäftigt seit über zehn Jahren mit entwicklungspolitischen Themen. Sein Beitrag erschien auch auf seinem Blog und zuerst auf dem Portal WI(e)SO – Wie sozial kann Wirtschaft sein.
Ausgabe 376 von: Kontext, Wochenzeitung
Ein Beitrag von Tomasz Konicz (13.06.2018)
Wer Freihandelsinteressen verficht, kämpft auch gegen Rechts? Ganz im Gegenteil. Der neoliberale Mainstream der vergangenen Dekaden bildete die Brutstätte der Neuen Rechten, die sich nun anschickt, diesen als dominierende Ideologie zu beerben.
Noch immer sind die Quellen unbekannt, aus denen die AfD ihre üppige Finanzierung während des Bundestagswahlkampfes bezog. Millionenbeträge kamen der Partei über einen dubiosen, formell unabhängigen "Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten" zugute, der den Wahlkampf der Rechtsextremisten durch groß angelegte Plakataktionen und den massenhaften Vertrieb von Gratiszeitungen (Kontext berichtete) unterstützte. Professionell Lücken in den Gesetzen zur Parteifinanzierung ausnutzend, deuteten viele Spuren der finanzkräftigen Hintermänner des Vereins in die Schweiz, insbesondere zu dem dort lebenden, erzreaktionären deutschen Mövenpick-Milliardär August von Finck. Seinen formellen Sitz hat der AfD-nahe Verein, der gerne im Hintergrund operiert, ausgerechnet in Stuttgart.
Es scheint auf den ersten Blick absurd, dass gerade in Stuttgart, der Kernregion der deutschen Exportwirtschaft, ein dubioses Finanzvehikel einer Partei seinen Stammsitz hat, die mit ihrer xenophoben Rhetorik den Freihandelsinteressen der Exporteure zuwiderläuft. Kürzlich etwa, nach einer ressentimentgeladenen Bundestagsrede der AfD-Frontfrau Alice Weidel, platzte Siemens-Chef Joe Kaeser der Kragen: Ihm seien die von Weidel verteufelten "Kopftuch-Mädel" lieber als der "Bund Deutscher Mädel", so der Vorstandsvorsitzende des Großkonzerns. Die AfD sei dabei, "mit ihrem Nationalismus dem Ansehen unseres Landes in der Welt" zu schaden, gerade dort, "wo die Haupt-Quelle des deutschen Wohlstands" liege.
Die liberale Welt scheint hier noch in Ordnung: Der weltoffene, global denkende Manager, dessen Unternehmen von der neoliberalen Globalisierung profitierte, stellt sich gegen den dumpfen Neo-Nationalismus der Rechtspopulisten, die daran gehen, die "Haupt-Quelle des deutschen Wohlstands" zu untergraben. Indes verdecken diese aktuellen Konflikte nur die tiefen ideologischen Kontinuitätslinien: Denn der rechtspopulistische Neonationalismus ist ein Produkt des neoliberalen Zeitalters mit seinen krisenbedingt zunehmenden sozioökonomischen Widersprüchen. Was am Beispiel der Bundesrepublik kurz skizziert werden soll.
Vom kranken Mann Europas zur Deutschland AG
Charakteristisch für den Neoliberalismus sind dessen sogenannte Reformen, die als Reaktion auf wirtschaftliche Stagnationstendenzen implementiert werden. So war es in der Bundesrepublik als dem vormals "kranken Mann Europas" ("Economist", 1999) die Agenda 2010 samt den Hartz-IV-Arbeitsgesetzen, mit denen das Nachkriegsmodell der sozialen Marktwirtschaft endgültig zu Grabe getragen wurde – und die zur Ausrichtung der Gesamtgesellschaft als "Deutschland AG" entlang des betriebswirtschaftlichen Kalküls führte. Die mit drakonischen Einschnitten bei Sozialleistungen, breiter Prekarisierung und krasser sozialer Spaltung einhergehende Hebung der Konkurrenzfähigkeit Deutschlands schien tatsächlich erfolgreich, sie führte ja zur Erringung von Exportweltmeisterschaften, von denen gerade Konzerne wie Siemens profitierten.
Doch zugleich lastet Hartz IV wie ein Alb über der deutschen Arbeitsgesellschaft. Die beständig mitschwingende Drohung mit totaler Verelendung hat die Machtverhältnisse endgültig zugunsten der Unternehmer verschoben. Die zunehmende Verdichtung und Entgrenzung des Arbeitslebens ließ nicht nur die Zahl der arbeitsbedingten psychischen Erkrankungen explodieren, sie verfestigte auch autoritäre Tendenzen bei vielen Lohnabhängigen, wie etwa der Sozialpsychologe Oliver Decker ausführt: "Die ständige Orientierung auf wirtschaftliche Ziele – präziser: die Forderung nach Unterwerfung unter ihre Prämissen – verstärkt einen autoritären Kreislauf." Sie führe zu einer "Identifikation mit der Ökonomie", so Decker, "wobei die Verzichtsforderungen zu ihren Gunsten in jene autoritäre Aggression münden, die sich gegen Schwächere Bahn bricht". Je stärker der zunehmende Druck auf den autoritär fixierten Lohnabhängigen lastet, desto größer sein Bedürfnis, schwächere Menschen genauso ausgepresst und ausgebeutet zu sehen.
Die neoliberale Verzichtspolitik fördert somit die autoritäre Aggression gegen die Krisenopfer, auf der rechtspopulistische wie rechtsextremistische Ideologien gleichermaßen beruhen. Evident wurde dies während der Sarrazin-Debatte, dem irren Urknall der Neuen Deutschen Rechten, als die mit der Agenda-Politik gerechtfertigte neoliberale Hetze gegen sozial marginalisierte Bevölkerungsschichten erstmals erfolgreich öffentlich mit rassistischen und sozialdarwinistischen Ressentiments angereichert wurde. Das neoliberale Feindbild des schmarotzenden, faulen Arbeitslosen verschmolz hierbei mit dem rechten Wahnbild des ausländischen, islamischen Schmarotzers, dessen ökonomische Unterlegenheit quasi genetisch kodiert sei.
Träger dieser ersten großen neurechten Hasswelle im Rahmen der "Sarrazin-Debatte" waren nicht etwa verarmte Bevölkerungsschichten, sondern die Mittelklasse als "Mitte" der Gesellschaft, die hier ihre Abstiegsängste nach dem Krisenausbruch in den Jahren 2007 und 2008 in Hass und Ausgrenzungsreflexe transformierte. Die Begriffe des Extremismus der Mitte und der konformistischen Rebellion sind folglich unabdingbar, um den Erfolg der Neuen Rechten und des Neo-Nationalismus als die ungeliebten Erben des Neoliberalismus zu verstehen.
Die Neue Rechte wähnt sich ja tatsächlich im Aufstand, während sie die schwächsten Gesellschaftsmitglieder angreift. Sie verschafft ihrer Anhängerschaft somit ein Gefühl von Rebellion, ohne sie den Gefahren der Rebellion – die sich immer gegen Herrschaft richtet – auszusetzen. Der Extremismus der Mitte ist das Geheimnis des Erfolgs der Rechten: Man verbleibt im eingefahrenen weltanschaulichen Gleis. Es findet hier kein ideologischer Bruch statt, sondern ein Ins-Extrem-Treiben der bestehenden Ideologie; der latent immer mitschwingende, barbarische Kern kapitalistischer Vergesellschaftung wird nun krisenbedingt manifest.
Zuallererst ist hier das Konkurrenzdenken mitsamt Sozialdarwinismus zu nennen, das der Neoliberalismus forcierte und gesamtgesellschaftlich entgrenzte – und das von der Neuen Rechten mit einem kulturalistischen oder rassistischen Überbau versehen wird. Das Survival of the Fittest findet nun nicht nur zwischen den Marktsubjekten statt, sondern auch zwischen Kulturen und Religionen. Aufbauen kann die AfD dabei auf den Hetzkampagnen der Massenmedien, die etwa während der Eurokrise daran arbeiteten, die Krisenursachen zu personalisieren (Faule Griechen/Italiener). Es findet faktisch eine Verselbstständigung dieser medial geschürten Ressentiments statt, die in den unkontrollierbaren Wahnräumen des Internets eine Eigendynamik entwickelten. Die Neue Rechte fordert Hetze in Permanenz. Die Krise scheint immer von außen durch bösartig agierende Gruppen in die anscheinend widerspruchslose Arbeitsgesellschaft hineingetragen zu werden.
Schon die frühere britische Premierministerin Margret Thatcher begründete ihre neoliberalen Reformen mit der Macht des Faktischen: "There is no Alternative". Die Personalisierung der Ursachen der gegenwärtigen Systemkrise baut folglich auf der Naturalisierung der spätkapitalistischen Gesellschaften auf: Diese erscheinen dem Neoliberalismus (Markt) und Neonationalismus (Nation) – mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung – als natürlicher Ausdruck der menschlichen Natur. Die zunehmenden Krisentendenzen können folglich nicht auf innere Widersprüche der natürlichen spätkapitalistischen Gesellschaften zurückgeführt werden, wie etwa die Krise der Arbeitsgesellschaft, sondern werden im schädlichen Wirken der Krisenopfer verortet. Die negativen Folgen der widersprüchlichen kapitalistischen Vergesellschaftung können so vom Neoliberalismus und Neonationalismus externalisiert werden: Sie erscheinen als negatives Wesensmerkmal einer Gruppe (Sozialschmarotzer, Flüchtlinge, etc.), mit der entsprechend zu verfahren ist.
Dabei bediente sich der Neoliberalismus schon immer gerne des Nationalismus, um seine gesellschaftliche Legitimität zu erhöhen. In der Bundesrepublik wurde im Gefolge der Agenda-Politik ebenfalls ein anscheinend unverkrampfter Patriotismus forciert, der seinen Durchbruch während der Fußball-Weltmeistersaft erlebte. Die nationale Identitätsproduktion diente auch als ideologischer Kleister, der die zunehmenden sozialen Gegensätze in der neoliberalen Krisenperiode überdecken soll. Eine zentrale Rolle spielte hierbei der Standortnationalismus: Die globalisierte Weltwirtschaft als eine Art Kampfschauplatz der nationalen Standorte, wobei die Exporterfolge der Deutschland AG als Ausweis der nationalen Überlegenheit begriffen wurden – und als Quelle von Ressentiments dienten.
Hieran, an das neoliberale Bild des im globalen Kampf stehenden nationalen Standortes, kann der Neo-Nationalismus nahtlos anknüpfen – und den einen Schritt weitergehen, der zum Bruch führt. Der qualitative ideologische Umbruch zwischen Neoliberalismus und Neo-Nationalismus vollzieht sich vor allem entlang der Haltung zur Globalisierung, die von der Neuen Rechten als Urquell aller krisenbedingten Übel, als Werk einer Verschwörerclique von "Globalisten" imaginiert wird.
Neonationaler Protektionismus wird neue Krisen auslösen
Dabei verwechselt die Neue Rechte einfach den historischen Krisenverlauf mit den systemischen Ursachen der Krise. Die Globalisierung mit ihren globalen Handelsungleichgewichten und dem globalen Schuldenturmbau bildete eine Systemreaktion auf eben jene zunehmenden inneren Widersprüche der kapitalistischen Warenproduktion, die weder Neoliberale noch die Neue Rechte wahrnehmen wollen: Der Spätkapitalismus ist längst zu produktiv für sich selbst geworden. Nur noch durch Kreditaufnahme kann die Massennachfrage für eine Weltwirtschaft aufrecht erhalten werden, die mit immer weniger Arbeitskräften immer größere Warenberge fabriziert. Deswegen stieg in den vergangenen Jahrzehnten die globale Verschuldung, mit Schwerpunkt USA, stärker an als die Weltwirtschaftsleistung.
Diesen Schuldenturmbau, der die entsprechenden Handelsdefizite zur Folge hat, wollen die USA unter Trump nun nicht mehr aufrecht erhalten. Dem qualitativen Umbruch in der Ideologie entspricht somit ein Umbruch im Krisenprozess: von der neoliberalen Globalisierung zum neonationalen Protektionismus, der einen neuen Krisenschub auslösen wird. Die Ideologie der neuen Rechten legitimiert diese neue, verschärfte Krisenphase, indem sie diese mit einer irren Binnenlogik auflädt: Als nationale Befreiung der Völkerschaften vom Joch der Globalisten-Verschwörung.
Der Neo-Nationalismus ist somit ideologischer Ausfluss der krisenbedingten Zuspitzung der sozioökonomischen Widersprüche im Spätkapitalismus, die der Neoliberalismus nicht mehr unter Kontrolle halten kann. Es ist mittlerweile eine Massenbewegung mit einer organisatorischen und ideologischen Eigendynamik. An die Macht kommt diese konformistische Rebellion aber nur dann, wenn nennenswerte Teile der Funktionseliten sie unterstützen. Und dies ist – noch – nicht der Fall, wie es die eingangs erwähnte Kritik von Joe Kaeser an Weidel illustriert. Entscheidend ist hier die Begründung des Siemens-Managers, der die Quellen des deutschen Wohlstands im globalisierten Ausland sieht. Doch was passiert, wenn der Protektionismus diese Quellen versiegen lässt? Dann dürfte die Ideologie der Neuen Rechten auch für weite Teile der deutschen Funktionseliten an Attraktivität gewinnen. Siemens-Chef Joe Kaeser repräsentiert somit die neoliberale Vergangenheit, AfD-Frau Weidel samt dem neurechten Abschottungswahn die Zukunft. Sie symbolisieren keine Gegensätze, sondern zwei Phasen in der voranschreitenden Barbarisierung des spätkapitalistischen Weltsystems.
____________________
Handelskrieg Eröffnet der Rückbau der globalen Güterketten Handlungsspielraum für ökosozialen Umbau?
Andrea Komlosy | aus FREITAG Ausgabe 13/2018
In der Geschichte des globalen Kapitalismus setzte Protektionismus dann ein, als sich westeuropäische Staaten, allen voran Großbritannien, im 18. Jahrhundert vom Freihandel abwandten und begannen, die einheimische Industrieproduktion gegenüber der damals den Weltmarkt beherrschenden asiatischen Konkurrenz zu schützen. Mit Zöllen, Import- und Konsumverboten ging die Sicherung der Absatzmärkte einher. Waffengewalt tat ein Übriges. Einmal an der Spitze, erfolgte der Wechsel zum Freihandel, um damit Bezugs- und Absatzmärkte zu sichern. Schutzmaßnahmen wurden nun von jenen ergriffen, die den Aufbau industrieller Kapazitäten auf ihrem Staatsgebiet fördern wollten: im 19. Jahrhundert vor allem Deutschland und die USA, im 20. Jahrhundert jene postkolonialen Staaten, die in Osteuropa und im globalen Süden aus den (Kolonial-)Reichen hervorgegangen waren. Aus der Perspektive der Marktführer, die Öffnung einforderten, wurde Protektionismus nun als Störung des freien Handels diffamiert.
Aus der Perspektive der Entwicklung, die mit der Entkolonisierung zum beherrschenden Topos der postkolonialen Staaten wurde, war der Schutz vor der übermächtigen Marktmacht der westlichen Großmächte eine zentrale Voraussetzung für die Überwindung ihrer Abhängigkeit. Die Strategien traten unter unterschiedlichen Leitideen auf: Abkoppelung, Dissoziation, Delinking, Dependencia, Autozentrierung. Sie ordneten sich unterschiedlichen Weltanschauungen von sozialistisch, national bis kapitalistisch zu, waren in der Praxis jedoch meist durch Pragmatismus geprägt, um die auf der Konferenz von Bandung im Jahr 1955 gefassten Vorstellungen eines selbstbestimmten Dritten Weges durch Ausnützen der Widersprüche des Kalten Kriegs am besten in die Tat umzusetzen.
Um ausländische Investitionen, Kredit, Technologie und Know-how zu erhalten, waren die Entwicklungsländer gezwungen, ihre Märkte für westliche Waren zu öffnen – insbesondere, seit von den 1970er Jahren an die Umwandlung der zentralisierten Fabrik am Konzernsitz in eine Kette von Produktionsstandorten einsetzte, an die einzelne Arbeitsschritte ausgelagert wurden. Diese sogenannten globalen Güterketten erforderten die bedingungslose Freiheit des Waren- und Kapitalverkehrs, um Komponenten just in time an die jeweils kostengünstigsten Standorte zu transferieren.
Einigen größeren Schwellenländern gelang es dabei, die untergeordnete Rolle als „verlängerte Werkbank“ am untersten Ende zum Aufstieg in wertschöpfungsintensivere Positionen in der Güterkette zu nutzen. Am erfolgreichsten dabei waren China und Indien. Beide konnten auf einer alten industriellen Tradition aufbauen, bis sie mit Kolonisierung (Indien) und „ungleichen Verträgen“ im Gefolge der Opiumkriege (China) im 19. Jahrhundert in die Knie gezwungen wurden. Nun stellten sie wieder ernsthafte Konkurrenten für die alten Industrieländer dar.
Chinas Handelsüberschuss beunruhigt die westlichen Märkte; noch beunruhigender sind die US-Staatsanleihen von über 1,2 Billionen Dollar in chinesischen Händen. Was unter Deng Xiaoping als Kontraktfertigung mit billigen und rechtlosen Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeitern begann, hat sich in der Zwischenzeit zu einem aufstrebenden Industrieland emanzipiert, das die Arbeiter und Arbeiterinnen seit der Wirtschaftskrise 2008 durch Lohnerhöhung und soziale Absicherung zunehmend mit Kaufkraft ausstattet. Im Westen wird oft herablassend bis feindlich über die unlauteren Wettbewerbspraktiken Pekings gesprochen, ohne zu bedenken, dass die Kombination von Öffnung und Protektion, Staat und Privatunternehmen, Innovation und Technologiespionage, Bündnispolitik und militärischem Säbelrasseln gerade jene Ingredienzien umfasst, die den westlichen Industrieländern zu ihrem Höhenflug verholfen haben.
Schwellenländer im Aufwind
Während die USA und Europa den Zenit ihrer Wirtschaftsmacht überschritten haben, befinden sich heute China, Indien, Vietnam und andere Schwellenländer im Aufstieg. Sie nutzen die Spielregeln des freien Wettbewerbs, welche die Welthandelsorganisation als unumstößlich aufgestellt hat, im eigenen Interesse und verbinden ihre neue Rolle in der Welt mit einheimischen kulturellen Werten und Traditionen.
Die alten Industriestaaten sehen sich von dieser Entwicklung aus ihrer Hegemonie gedrängt. Die Bastionen aus Vermögen, Know-how und Macht über Institutionen, die sie immer noch innehaben, können ihre Privilegien nicht mehr schützen. Es setzen Verteilungskämpfe nach innen – die Reichen werden immer reicher – und nach außen hin ein. Der viel geschmähte Protektionismus kehrt auf die Tagesordnung zurück: Die Rede ist von Reindustrialisierung und von Strafzöllen; auch die Formierung von Wirtschaftsblöcken zur Verbesserung der einzelstaatlichen Konkurrenzfähigkeit ist Ausdruck dieses Machtverlusts. Die Europäische Union schiebt den Schwarzen Peter gerne den USA und ihrem Präsidenten Donald Trump zu, agiert aber im Grunde mit den gleichen Mitteln: Auge um Auge, Zahn um Zahn, jedoch vereint in der Abwehr der aufsteigenden Schwellenländer.
Was wollen die Protektionismen im Abstieg bewirken? Industrie und Arbeitsplätze sollen an die alten Standorte zurückgebracht werden. Zölle verteuern dieImporte und sollen à la longue zur Importsubstitution führen. Importverbote schützen die einheimische Produktion vor billigerer ausländischer Konkurrenz. US-Zölle und Importbarrieren werden Unternehmen motivieren, Produktionsstätten in die USA zu verlagern. Ein Rückbau der Güter- und Standortketten zugunsten einer Lokalisierung der Produktion ist denkbar. Es wäre der Beginn einer weltwirtschaftlichen Trendwende in Richtung Regionalisierung.
Sollen Kritiker der globalen Ungleichheit angesichts der vollmundigen „Great“- und „First“-Ansagen alter Industrieländer in den Chor der liberalen Freihandelsapologetik einstimmen und von den Protektionisten Marktoffenheit einfordern?
Ich plädiere dafür, diese Ansagen trotz des präpotenten Muskelspiels, welches sie begleitet, als Chance zu begreifen. Erstens öffnen sie Denkraum dafür, die Mär der wohlstandsfördernden Effekte eines ungehinderten Kapital- und Warenverkehrs zu hinterfragen. Die neomerkantilistische Selbststärkungsstrategie der alten Zentren öffnet einen Spielraum. Aus ökologischer, sozialer und entwicklungspolitischer Perspektive könnte daran angeknüpft werden, um der krisenhaften Zuspitzung der Verhältnisse zu entkommen.
Ich bin mir bewusst, dass die Protektionismen der alten Industriemächte eine solche Alternative nicht im Auge haben. Ob ihre Kehrtwende in Sachen Deglobalisierung tatsächlich den Handlungsspielraum für sozialökologische Alternativen öffnet oder auf Krieg zusteuert, hängt nicht von den Zöllen ab, sondern davon, ob die Waffen, die sich trotz des Verlusts ökonomischer Führung in ihren Arsenalen konzentrieren, zum Einsatz gebracht werden.
Andrea Komlosy lehrt Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien. Sie hat gerade das Buch "Grenzen. Räumliche und soziale Trennlinien im Zeitenlauf" (Promedia 2018, 248 S., 19,90 €) veröffentlicht