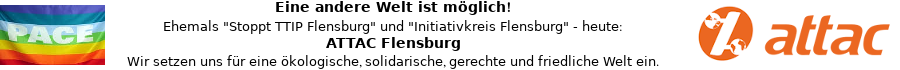Vorbemerkung: Wohl kaum eine Wirtschaftsjournalistin oder ein Wirtschaftsjournalist neben Ulrike Herrmann schafft es mit soviel Weitblick, auch für Laien verständlicher Schreibe und mit so präziser Argumentation wie Stefan Kaufmann die finanz-und wirtschaftspolitische Entwicklung unserer Zeit zu analysieren. Er schreibt regelmässig für die FR und das nd. (hn)
Stefan Kaufmann: erstellt am 23.01.2020
Im globalen Geschäft sind die Zeiten rauer geworden. Das wird sichtbar schon daran, dass sich Analysen der internationalen Wirtschaft zunehmend des Vokabulars der Kriegsberichterstatter bedienen. Die Zeit sieht Deutschlands Industrie im „Duell mit China". Mit der Annahme chinesischer Investitionen werde Italien zum „Brückenkopf" Pekings in Europa, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Und die FAZ warnt davor, dass Tschechien zu „Chinas Flugzeugträger" in Europa werde.
Es droht - oder herrscht - Wirtschaftskrieg zwischen den großen Mächten. Die meisten liberalen Ökonomen reagieren darauf mit Unverständnis. Wenn Asien wachse, gebe es neue Möglichkeiten der Kooperation zum gegenseitigen Vorteil, argumentiert Jan Schnellenbach und fügt an: „Versteht doch mal, dass Marktwirtschaft kein Krieg ist!" Das stimmt. Aber mit Marktwirtschaft lässt sich Krieg führen.
Denn die neoliberale Idee des freien Spiels der Marktkräfte ist zurückgetreten. An ihre Stelle rückt eine Politik, in der die Sphären der Wirtschaft, der Finanzen, des Militärs und der Außenpolitik miteinander verschmelzen: Zur Geopolitik kommt die Geoökonomie. Europa, China und die USA schützen ihre Unternehmen vor Übernahmen durch das Ausland. Regierungen untersagen Geschäfte mit chinesischen Zulieferern wie Huawei, russischen Rohstofflieferanten wie Gazprom oder ganzen Staaten wie Iran. Sie rüsten ökonomisch auf, schaffen oder stützen nationale „Champions" und verlagern globale Wertschöpfungsketten in ihren Machtbereich. Sie finanzieren technologische Innovationen und bauen lokale Industriezweige - zum Beispiel für Batterien - auf, um vom Ausland nicht abhängig zu sein beziehungsweise um das Ausland von sich abhängig zu machen. Dies alles mit dem Argument, die nationale Souveränität zu erhalten.
Nun ist Gegnerschaft nichts Neues. Wirtschaft findet im Kapitalismus als Wettbewerb statt. Da das Miteinander als Gegeneinander organisiert ist, sind die Übergänge zwischen normaler Konkurrenz und „Wirtschaftskrieg" fließend. Im Geschäftsverkehr der Weltmächte sind jedoch neue Umgangsformen zu beobachten. Der eigene Misserfolg wird nicht länger als Ergebnis des Marktes wahrgenommen, sondern als Ausfluss eines bösen Willens der Konkurrenten. Die Gegenseite, so die Beschwerde, verhalte sich unfair, regelwidrig. Kooperation wird zur „Abhängigkeit", das Ausland von der Chance zur Gefahrenquelle.
Ziel ist, den Willen der Gegenseite zu brechen. Um dies zu erreichen, werden Maßnahmen getroffen oder angedroht, die die Kooperationspartner explizit schädigen oder schwächen sollen. Eventuelle eigene Verluste sind dabei eingeplant und akzeptiert. So hat Donald Trumps Handelspolitik die USA vergangenes Jahr per Saldo 1,4 Milliarden Dollar pro Monat gekostet, errechnen Ökonomen der Universitäten Princeton und Columbia. Doch das zählt für Trump nicht. „Spielt die EU nicht mit, werden wir sie zur Hölle besteuern", droht er. Die Gegenseite zu schädigen und selbst Schäden hinzunehmen erfolgt ohne unmittelbaren eigenen geldwerten Vorteil, sondern ist Mittel zum Zweck, den Partner zu kontrollieren. Man geht in den Konflikt. Auch wenn das oft anders beschrieben wird: Dieser Konflikt ist das Gegenteil von Abschottung.
„Wir sind nicht naiv"
Es sind neue Zeiten. Regierungen nutzen nicht mehr nur ihre Möglichkeiten, um heimischen Unternehmen per Liberalisierung den Weg freizuräumen. Vielmehr schränken sie vielfach den freien Markt ein, lassen seine Ergebnisse nicht mehr gelten und stellen sie unter politischen Vorbehalt. Der Wille ihrer Wirtschaft ist der Politik nicht mehr Befehl. Umgekehrt nutzt die Politik die heimischen Konzerne als Ressource, um ihre Nation im globalen Streben nach Dominanz zu stärken und die anderen zu schwächen. „Die Grenzlinien zwischen Kriegs- und Friedenszuständen werden immer undeutlicher", schreiben Nils Ole Oermann und Hans-Jürgen Wolff in ihrem neuen Buch Wirtschaftskriege.
Ökonomen müssen deshalb umdenken. Die liberale Fraktion hielt den globalen Handel stets für einen Verhinderer von Krieg. Denn wer miteinander Geschäfte mache und kooperiere, der sei vom Wohlergehen und Wohlwollen des Kontrahenten abhängig. Aber so einfach ist die Sache nicht. Das zeigt schon das Wort „Kontrahent", das den Vertragspartner wie auch den Gegner bezeichnet. In Frage gestellt wird aber auch die alte „linke" Annahme, Krieg werde nur für den Profit geführt - eine Annahme, die sich in Parolen wie „Kein Blut für Öl!" ausdrückte oder in Berechnungen, wie die Rüstungsindustrie von Kriegen profitiert. Was sich weltpolitisch derzeit abspielt - Brexit, Handelskrieg, Europas Kritik an chinesischen Investitionen -, das haben sich die Konzerne nicht bestellt, im Gegenteil: Es schadet ihnen zunächst.
Deutlich wird dies am Fall Huawei. Der chinesische Netzwerkausrüster verfügt über billige, gute Technologie, an welcher westliche Telekomkonzerne und Standorte Interesse haben. Dennoch sperrt Washington Huawei aus dem US-Markt aus und drängt die europäischen und asiatischen Staaten dazu, mitzutun. Damit wollen die USA Chinas Aufstieg zur Hightech-Macht unterbinden. Vizepräsident Mike Pence nannte die „technologische Vorherrschaft" der USA eine Bedingung für deren „nationale Sicherheit". Washington will verhindern, dass der chinesische Staat über Huawei Zugriff auf sensible Daten der USA oder anderer Staaten erhält. Die Möglichkeit, heimische Hightech-Firmen als Quelle für ausländische Daten zu benutzen, behält Washington sich selbst vor. Dass Peking mit Huawei das Gleiche versuchen könnte, begreift die US-Regierung als Angriff auf ihre digitale Einflusssphäre weltweit.
Schließlich will sie verhindern, dass Peking über die Ausrüstung ausländischer Netze ein politisches Machtmittel in die Hand bekommt, mit dem Huawei auf Anweisung der Regierung ausländische Netze gezielt stören könnte. Washington kalkuliert hier offensichtlich mit einer Eskalation. Denn „umfassende Störungen" von Netzen durch den Ausrüster sind laut der Stiftung SWP in Berlin „allenfalls im Falle massiver zwischenstaatlicher Auseinandersetzungen denkbar". Dann aber schon.
Die EU-Staaten wehren sich noch gegen Amerikas Huawei-Verbot, teilen aber die Bedenken gegen China. „Wir sind nicht naiv", sagt Thomas Gassilloud vom französischen Verteidigungsausschuss. Bei ihrer Entscheidung zu Huawei berücksichtige die Pariser Regierung „sowohl die Sicherheit der Netze wie auch unseren Platz im internationalen Wettbewerb". Sprich: Wettbewerbsfähigkeit allein zählt nicht mehr.
Altmaiers Nationalismus
In Deutschland klingt aus der „Nationalen Industriestrategie 2030" des deutschen Wirtschaftsministeriums ein „unverhohlen nationalistischer Ton", konstatiert der Ökonom Jeromin Zettelmeyer. Ziel der von Peter Altmaier als Wirtschaftsminister vorgelegten Strategie ist zum einen, den Anteil der Industrie in Deutschland zu erhöhen. Das ist eine Kampfansage. Denn dieses Ziel wäre nur zu erreichen, indem Deutschland den anderen Staaten Marktanteile abnimmt. Zudem sollen Wertschöpfungsketten der Unternehmen zunehmend nach Europa verlagert werden, „vermutlich weil sie dann widerstandsfähiger gegen geopolitische Störungen sind", so Zettelmeyer. Die Stärkung der Industrie soll laut Wirtschaftsministerium auch verhindern, dass Deutschland „strategische Sektoren" der Wirtschaft ans Ausland „verliert" und damit an „Souveränität" einbüßt. Um dieser Gefahr zu begegnen, sollen nationale Großkonzerne, „Champions", geschmiedet werden. Fallweise will der Staat die Übernahme deutscher Firmen durch das Ausland verhindern, auch mit dem Erwerb staatlicher Beteiligungen.
Gegen die deutsche Industriestrategie wenden Ökonomen ein, die politische Steuerung von Wertschöpfungsketten führe zu Effizienzverlusten. Doch für das deutsche Ministerium scheint wichtiger, dass diese Ketten unter politischer Kontrolle Deutschlands stehen. Gegen die Schaffung nationaler Großkonzerne wenden Ökonomen ein, derartige Champions seien nicht unbedingt rentabel. Für das Wirtschaftsministerium allerdings zählt hier nur eines: Sie sind deutsch.
Alles Ökonomische wird auf einmal zu einer Frage der Nationalität. Zwar gibt es massenweise Banken auf der Welt - doch will die Bundesregierung eine aus Deutscher Bank und Commerzbank fusionierte deutsche Großbank. Zwar ist weltweit effiziente Technologie verfügbar - doch kommt sie nicht aus Deutschland. Zwar existieren Zulieferer für die hiesigen Unternehmen - doch sind sie außerhalb der politischen Kontrolle der Bundesregierung. Zwar wollen viele Investoren sich an deutschen Unternehmen beteiligen - doch haben sie die falsche Nationalität. Das Ausland wird zum Risiko. Zur „Nationalen Industriestrategie" passt daher die Aufstockung des deutschen Militäretats und der Aufbau einer europäischen „Verteidigungsidentität".
Mit „Protektionismus" ist die gegenwärtige Lage nicht beschrieben. Keiner Seite geht es darum, die Konkurrenten sich selbst zu überlassen. Sondern darum, sie zu nutzen. Es ist auch keine Rückkehr des ökonomischen Nationalismus, denn der war nie weg. Den freien Welthandel betrieben die ökonomischen Großmächte nie aus Uneigennützigkeit, sondern als Mittel für ihren nationalen Wohlstand. Es scheint, als könnten sie diesen Wohlstand heute nur noch gegen den Widerstand des Auslands sichern und mehren. Die Regierungen sammeln daher ihre Potenzen, um diesen Widerstand notfalls zu brechen. Das ist kriegsträchtig.
Heute ringen die Weltmächte nicht mehr nur um Marktanteile und Wettbewerbsfähigkeit, also um ihre Position in der Konkurrenz. Sie kämpfen um die Gestaltung der Konkurrenz selbst, um die Regeln des globalen Geschäftsverkehrs und um ihre Machtposition. Dabei sind sie bereit, Wertschöpfung zu opfern. Um ihre Dominanz zu sichern, stellen die Regierungen der USA und anderer Mächte kurzfristige Profitinteressen zurück und nutzen ihre Wirtschaftskraft so als Waffe. So praktizieren nicht die Weltmarktverlierer, sondern die Weltmarktgewinner eine Globalisierungskritik von rechts - nicht im Namen der Klasse, sondern im Namen der Nation.
Von Raul Zelik in der WOZ (Schweiz) Nr. 14/2020 vom 02.04.2020
Coronakrise
Die Pandemie bedroht das Leben und die wirtschaftliche Existenz von Millionen – und doch verweist die globale Krise auch auf die Möglichkeit einer besseren Zukunft. Über einen historischen Augenblick extremer Offenheit.
Vergangene Woche, als die Krankenhäuser in Madrid bereits kollabierten, ein Vorort von Barcelona wegen der Covid-19-Pandemie komplett abgeriegelt wurde und die ersten Bilder aus den Notkrankenhäusern in der Lombardei um die Welt gingen, eröffnete der katalanische Autor und Philosoph David Fernàndez seine regelmässige Kolumne in der Tageszeitung «Ara» mit merkwürdig utopischen Zeilen: «Das Wasser in Venedig ist klar. Der Mercat de la Boqueria verwandelt sich wieder in einen Stadtteilmarkt. Hotels in Paris öffnen ihre Pforten für Obdachlose. Das Abschiebegefängnis in der Freihandelszone von Barcelona ist geschlossen worden. Zwangsräumungen sind ausgesetzt. In den Kaufhäusern des Corte Inglés herrscht kein Gedränge. Und was normalerweise Profit erwirtschaften soll, wird – per Dekret – in den Dienst der Öffentlichkeit gestellt.»
Nach diesen ersten Sätzen hätte man meinen können, es handle sich um einen dieser Beiträge, die uns gerade die Lage schönzureden versuchen. Doch der Artikel verwies im direkten Anschluss daran auch auf die andere Seite: Strafen und Polizeieinsätze gegen Obdachlose, Reiche, die in ihre Ferienhäuser fliehen, der grassierende Rassismus der sozialen Netzwerke und die Wetten der Hedgefonds gegen überschuldete Staaten. Fernàndez wollte die Lage nicht beschönigen, sondern darauf aufmerksam machen, wie einzigartig die Lage ist: Völlig unvermittelt befinden wir uns in einer Situation extremer Offenheit.
Bei vielen Texten, die in diesen Tagen erschienen, hat man sich als LeserIn verwundert die Augen gerieben, weil die AutorInnen nur das zu wiederholen schienen, was sie eigentlich immer sagen. Giorgio Agamben sah den biopolitischen Staat am Werk, der das Instrumentarium des Ausnahmezustands an uns erproben will, Slavoj Zizek kam vom Virus auf Hegel zu sprechen, der deutsche Soziologe Heinz Bude proklamierte die Rückkehr des sozialdemokratischen Nationalstaats, und so mancheR Umweltbewegte flüchtete sich in die alte, jetzt allerdings besonders reaktionäre Floskel: «Sind nicht wir Menschen der eigentliche Virus auf der Erde?»
Die Pandemie als Krisenbeschleuniger
Aber wäre es nicht viel angemessener, sich darüber zu wundern, was sich innerhalb weniger Tage alles geändert hat? Es hat den Anschein, als würde die schon lange heraufziehende grosse ökologisch-ökonomische Krise durch die Pandemie beschleunigt und verdichtet werden. Auf der einen Seite sind die dystopischsten Szenarien auf einmal konkret. Viele Millionen Menschen sind in ihrer Existenz bedroht, weil kaputtgesparte Gesundheitssysteme sie nicht versorgen können, sie kein Geld mehr verdienen und eine Umverteilung der obszönen Privatvermögen nach wie vor undenkbar erscheint. Die Globalisierung ist abrupt ausgesetzt, die Produktionsketten sind unterbrochen, die Finanzmärkte taumeln am Abgrund. Und was eine militärische Supermacht wie die USA tun wird, wenn die Gesellschaft im Inneren aus den Fugen gerät, möchte man sich lieber nicht weiter ausmalen. In Frankreich patrouillieren Militärs auf den Strassen, und Macron kann das Wort «Krieg» gar nicht oft genug in den Mund nehmen. Im eigentlich links regierten Spanien verkündet der Oberkommandierende der Streitkräfte in einer Pressekonferenz mit den MinisterInnen, die Bevölkerung bestehe jetzt nur noch aus Soldaten, und es gebe kein Wochenende mehr (sic!).
All das ist real. Doch wahr ist eben auch das Gegenteil. In vielerlei Hinsicht verweist die Reaktion auf die Pandemie auch auf die Möglichkeit einer besseren Zukunft. Davon, dass sich in allen Städten spontan Solidaritätsnetzwerke gründen, um NachbarInnen zu versorgen, ist in den meisten Zeitungen schon die Rede gewesen. Wieder einmal zeigt sich, dass in Krisenmomenten der erste menschliche Reflex nicht der Hobbes’sche Bürgerkrieg aller gegen alle, sondern die Hilfsbereitschaft ist. Doch auch der staatliche Lockdown hat durchaus etwas Utopisches. Die grössten Einschränkungen des Soziallebens werden verordnet und akzeptiert, um die Schwächsten zu schützen, denn der einzige Zweck der Massnahme besteht darin, die medizinische Versorgung derjenigen zu sichern, die wegen ihres Alters und aufgrund von Vorerkrankungen auf die Intensivstation müssen. «Flatten the curve» ist eben nicht das Recht des Stärkeren, sondern Solidarität, denn in der Sprache des Marktes wären diese Risikogruppen nur ein «Kostenfaktor», und die Reichen könnten sich ihren Platz in der Privatklinik sichern. Die Tatsache, dass sich die Gesellschaft dem Markt verweigert und die Prioritäten – zumindest für ein paar Tage – anders setzt, ist keine Kleinigkeit.
Es ist nicht das einzige Zeichen dieser Art. Die von den europäischen Regierungen ergriffenen Notmassnahmen sollen zwar in erster Linie die Konzerne und Banken (oder ihre superreichen EigentümerInnen) retten, aber tragen doch immerhin dazu bei, den neoliberal domestizierten Vorstellungshorizont wieder zu öffnen. Ideen, die zuvor als sozialistisches Teufelszeug galten, werden unter dem Applaus der Medien innerhalb von 48 Stunden durch die Parlamente gepeitscht. BörsenexpertInnen plädieren für die Verstaatlichung von Unternehmen, um sie vor feindlichen, sprich ausländischen Übernahmen zu schützen. Finanzminister setzen entschlossen die verfassungsrechtlich verankerte Austeritätsdoktrin ausser Kraft. In der EU-Kommission halten viele die europäischen Staatsanleihen, die den vermeintlichen «Verschwenderstaaten» des Südens bisher immer verweigert wurden, auf einmal doch für eine mögliche Option. In den USA wird «Helikoptergeld» verteilt – was die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens in ganz anderem Licht erscheinen lässt. In Frankreich werden notleidenden KleinunternehmerInnen per Präsidialdekret Mieten, Strom- und Wasserzahlungen erlassen, was schon allein deshalb erstaunlich ist, weil die Politik doch angeblich gar keine Handhabe bei Privatverträgen hat, und Grossunternehmen und HackerInnen kooperieren bei Experimenten der Industriekonversion: Automobilzulieferer sollen auf die Fertigung von Medizingeräten umstellen, weil die Beatmungsgeräte nicht ausreichen. Zumindest für einen Augenblick ist die bedürfnisorientierte, demokratische Planung der Wirtschaft, die den Kern jedes sozialistischen Projekts ausmacht, eine reale Option.
Plötzlich werden die Klimazeile erreicht
Auch vieles von dem, was aus klimapolitischen Gründen zwingend notwendig wäre und seit langem gefordert wird, ist plötzlich Realität. Flugzeugflotten bleiben auf dem Boden, Kreuzfahrtschiffe dürfen nicht mehr ablegen, der völlig überdrehte Massentourismus, der Millionen Menschen zum Biertrinken an Orte befördert, an denen es dank der Tourismusindustrie genauso aussieht wie zu Hause, kommt zum Erliegen. Satellitenbilder zeigen, dass die Luftverschmutzung nicht nur in China, sondern auch in Norditalien innerhalb weniger Tage dramatisch zurückgegangen ist. Und in Deutschland werden die klimapolitischen Ziele für 2020 – eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um vierzig Prozent gegenüber dem Jahr 1990 – jetzt mit Sicherheit erreicht.
Das alles sind natürlich trotzdem keine guten Nachrichten, denn die Covid-19-Pandemie bringt Millionen Menschen fürchterliches Leid. In Teilen Südeuropas ist es schon jetzt so, dass Menschen über 65 auf den Intensivstationen nicht mehr versorgt werden. Die Alten sterben allein und verlassen. Und auch wenn die Pandemie global ist, unterscheidet sie sehr genau zwischen Nationen und Klassen: In Deutschland stehen umgerechnet auf die Bevölkerung vier mal so viele Plätze auf der Intensivstation zur Verfügung wie in Spanien, das im internationalen Vergleich immer noch unvergleichlich viel besser dasteht als die Länder des Globalen Südens. Wer in einer Villa in Hamburg-Blankenese oder Wollerau wohnt, kann Homeoffice im Garten machen und die Entschleunigung geniessen, während die in Wohncontainer eingesperrten Geflüchteten oder die alleinerziehende Mutter mit dem Kind in der dunklen Eineinhalbzimmerwohnung wahrscheinlich gerade durchdrehen.
Nichts ist gut, und doch sollten wir erkennen, in welchem Moment wir uns befinden: Die kapitalistische Globalisierung ist für einen Moment ausgesetzt. Es ist, als hätte jemand abrupt die Bremse gezogen, und unweigerlich fällt einem der düstere Satz Walter Benjamins ein: «Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotiven der Weltgeschichte. Aber vielleicht ist dem gänzlich anders, vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem Zuge reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse.» Dass dieser Moment des Stillstands schön oder heiter sein würde, hat niemand behauptet. Aber immerhin zwingt er uns, darüber nachzudenken, was wir eigentlich machen, und zumindest drei Dinge könnten wir erkennen: Erstens, dass das Hamsterrad, in dem wir eingesperrt sind, sehr wohl angehalten werden kann. Was jetzt gefährdet ist, ist nicht die Grundversorgung mit dem Lebensnotwendigen – Wohnung, Strom, Medikamenten, Nahrungsmitteln und so weiter –, die offenbar auch dann noch relativ stabil weiterläuft, wenn grosse Teile der Wirtschaft zum Erliegen gekommen sind. Wer am Rand des Abgrunds taumelt und uns mit hinabzureissen droht, sind die Konzerne, Fonds und Banken, die unablässig ihren Wert vermehren müssen. Das, was gemeinhin als «die Wirtschaft» bezeichnet wird, hat also offenbar gar nicht so viel mit Bedarfen und Bedürfnissen zu tun. Wir leisten uns eine Ökonomie, die sich nicht an den Grundlagen des Lebens, sondern an der Wertschöpfung orientiert.
Zweitens erleben wir parallel zur Renaissance von Grenzschliessung und Nationalismus die reale Verbindung unter uns Menschen. Ein Virus, das sich von Körper zu Körper reproduziert, hat sich innerhalb weniger Wochen durch Körper auf dem ganzen Planeten gearbeitet. Das ist unsere reale Distanz zu einer Fabrikarbeiterin in Wuhan: Jene Sequenz Ribonukleinsäure, gegen die ihr Körper noch vor drei Wochen kämpfte, hat nun uns erreicht – nur ein paar Handschläge und Umarmungen weiter.
Das dritte allerdings scheint mir das Wichtigste: Schlagartig wird uns bewusst, dass es am Ende immer nur um das Leben geht und jede gesellschaftliche und ökonomische Ordnung eingebettet bleibt in ein «Netz des Lebens», wie es der marxistische Umweltökonom Jason W. Moore genannt hat. Für dieses Netz, das wir niemals völlig kontrollieren werden, tragen wir Sorge – weil es die Grundlage unseres Daseins ist. Wie wäre es, wenn wir unsere Gesellschaft auch dementsprechend organisierten?
Die entscheidenden Fragen
Es gibt unzählige Gründe, sich Sorgen zu machen. Die Schliessung der Grenzen wird die Konkurrenz befeuern, die Unterbrechung der transnationalen Wertschöpfungsketten die Herausbildung von Regionalblöcken verstärken, die dann schon bald auch militärisch um Rohstoffe kämpfen dürften, und es droht die grösste Wirtschaftskrise der Geschichte. In unserer Nachbarschaft erleben wir, wie Menschen Psychosen entwickeln. Wir beobachten Hamsterkäufe, die – wenn sich der drollige Klopapierfetischismus einmal gelegt hat – schon bald schlimme Konsequenzen haben können. Aber da ist eben auch das Gegenteil: GesundheitsarbeiterInnen, die alles geben, obwohl sie Gefahr laufen, sich selbst anzustecken und zu sterben; Menschen, die sich zum Spielen und Musizieren auf dem Balkon verabreden; bürgerliche PolitikerInnen, die auf einmal die Verteidigung einer öffentlichen und unentgeltlichen Grundversorgung als Priorität für sich entdecken. Eine ganze Gesellschaft scheint für ein paar Tage den Feminismus und die Sorge umeinander für sich entdeckt zu haben.
Wenn es einen Lichtblick gibt, dann sind es die von der Pandemie aufgeworfenen Fragen: Wenn öffentliche Infrastrukturen wie das Gesundheitswesen offenbar die Grundlage unseres Lebens herstellen, warum stehen sie dann nicht im Mittelpunkt jeder ökonomischen Theorie? Wenn Krankenpflegerinnen, Kassierer und TransportarbeiterInnen «systemrelevant» sind, weshalb werden sie dann nicht entsprechend bezahlt? Weshalb halten wir Marktgesellschaften für etwas Gutes, wenn doch der Markt in jeder schwierigen Situation Panikkäufe und Warenknappheit produziert? Warum werden die Börsen, die sich auch diesmal wieder einmal als tickende Zeitbomben erwiesen haben, nicht endlich geschlossen oder zumindest radikal reglementiert? Weshalb ist es normal, dass wir mit Milliarden Euro Steuergeldern Grosskonzerne retten, aber undenkbar, dass wir dann auch demokratisch darüber entscheiden, was, wo und unter welchen Bedingungen diese Unternehmen produzieren? Und warum treiben wir in einer Zeit, in der sich immer mehr Krisen nur global lösen lassen – für den Klimawandel gilt das ja genauso wie für Pandemien –, nicht viel entschlossener den Aufbau globaler Strukturen voran?
Die Krise wirft zentrale Fragen auf und lässt die notwendigen Lösungen aufblitzen. Eine Maschine, die nicht der Bewahrung des Lebens, sondern der unbegrenzten Vermehrung des Werts verpflichtet ist, ist zum Stehen gekommen, und nur solidarisch und uns umeinander sorgend werden wir die Situation überstehen.
Die Philosophin Marina Garcés, ebenfalls aus Barcelona, weigerte sich im katalanischen Fernsehen dieser Tage, die ganz grossen Fragen zu stellen und zu beantworten. Aber auf die Frage des Moderators, ob wir uns jetzt nicht unserer menschlichen Verletzlichkeit bewusst würden, antwortete sie, die Situation führe uns weniger die menschliche Fragilität als die des Systems vor Augen. Die prekär Beschäftigten, Alleinerziehenden, Kranken und Alten seien sich ihrer Verletzlichkeit eigentlich immer bewusst, doch normalerweise seien das individuelle Probleme. Jetzt hingegen würden wir diese Erfahrung kollektiv und gleichzeitig teilen.
Die Pandemie ist ein Scheideweg – entweder wir entscheiden uns für ein Projekt des Lebens und der Sorge umeinander oder für eines der beschleunigten gesellschaftlichen Zerstörung.

Marktplatz Memmingen, 2. Mai 2020. Bild: Wald-Burger8/CC BY-SA 4.0
Die politischen Gefahren der Corona-Krise. Wie steht es mit der "Tendenz zur Diktatur"?
Was kommt nach der aktuell fortdauernden Corona-Krise, auf die nach allgemeiner Erwartung wirtschaftliche Verwerfungen folgen werden - und welche politischen Gefahren drohen dabei?
Ein Risiko wurde dabei in diesen Spalten bereits benannt, in Gestalt dieser Fragestellung:
"Werden wir also (…) in den Regionen, die am stärksten von der Pandemie hinsichtlich der Opferzahlen betroffen wurden, einen Gang ins ausländerfeindliche Rechtsextreme erleben? Oder insgesamt einen Drift zum Rechtsextremen oder Völkisch-Nationalem?" (Hat die Spanische Grippe Deutschland in den Faschismus geführt? [1])
Vorbemerkung: Ein sehr spezifisch deutsches Partikularphänomen
In den folgenden Ausführungen soll dabei vor allem den Positionen und Strategien der zur extremen Rechten zählenden Kräfte selbst nachgegangen werden und dies in mehreren Ländern zugleich. Keine, jedenfalls abschließende Antwort kann dadurch auf die Frage gegeben werden, wie andere gesellschaftliche Akteure nun ihrerseits damit umzugehen haben - und vor allem, wie sich Linke und andere Kräfte zu Protesten verhalten sollen, an denen auch, aber nicht ausschließlich faschistische, verschwörungtheoretisch argumentierende und andere feindliche Kräfte teilnehmen.
Man denkt dabei unwillkürlich an die so genannten "Corona-Demonstrationen", die in der Form, wie sie derzeit in unterschiedlichen Städten in Deutschland stattfinden, tatsächlich ein sehr spezifisch deutsches Partikularphänomen darstellen - da liegt die bürgerliche [2] Presse [3] völlig richtig.
In Frankreich, Italien oder Spanien oder im Vereinigten Königreich gibt es jedenfalls keinerlei Äquivalent dazu; vielleicht fällt es in Deutschland auch deswegen ungleich leichter, genau gegen diese Maßnahmen auf die Straße zu gehen, weil dieses Land im Unterschied zu den vorgenannten Staaten (mit ihren weitaus höheren Totenzahlen) bislang relativ glimpflich durch die sanitäre Krise kam.
Auf einem anderen Blatt steht dabei, ob dies auch dann der Fall war, hätte man die Regierungsmaßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 unterlassen.
Dieses Phänomen ruft, wie sich auch aus den vorausgegangenen wochenlangen Diskussionen bei Telepolis ablesen lässt, auch innerhalb der - im weitesten Sinne gefasst - politischen Linken offensichtlich konträre Standpunkte hervor.
Der Autor dieser Zeilen hat eine Auffassung zu der Sache, jedoch kein Patentrezept zur Auflösung des Problems aufzubieten. Denn gäbe es eine Wunderlösung dafür, dann würde diese wahrscheinlich bereits Anwendung finden. Ein Axiom (d.h. als richtig vorausgesetzte Ausgangsbehauptung) soll dabei dennoch festgehalten werden.
So einfach wie manche Autoren, die sich das Problem gerne klein- oder schönzureden versuchen, um etwa als langjähriger Bewegungsmanager mal wieder an eine - vermeintliche - soziale Bewegungsdynamik andocken zu dürfen, darf man es sich nicht machen.
Wenn man etwa die gemeinhin als Corona-Demonstrationen bezeichneten Versammlungen im öffentlichen Raum einfach mal zu "Grundrechtsprotesten" und "Grundrechtsdemos" [4] deklariert und darüber eine ziemlich eindeutige und nahezu widerspruchsfreie Definitionsmacht für sich beansprucht, dann kann es nur schief gehen.
Jedenfalls wird über eine solche begriffliche und definitorische Vereinheitlichung jeglicher analytische Anspruch von vornherein aufgegeben, zugunsten einer Bewegungshuberei, die nach Einfluss unter den vermeintlichen Massen auf den Versammlungen - um die sich die Rede dreht - strebt.
Was aber, wenn ein als solcher bezeichneter "Grundrechtsprotest" im Konkreten unter anderem beinhaltet, wenngleich ohne sich darin zu erschöpfen, dass buchstäblich bekennende Nationalsozialisten Grundgesetze verteilen wie hier [5]?
Das Anliegen
Nein, das hat es übrigens in der Anti-AKW-Bewegung der 1970er oder der Friedensbewegung der 1980er Jahre in solcher Form überhaupt nicht gegeben, da wären die bekennenden Nazis eher schnell gelaufen. Im zuvor zitierten Beispiel ging es um einen Stadtrat der offen neonazistischen Kleinpartei "Die Rechte" in Dortmund. Dessen Partei zählt im niedersächsischen Braunschweig zu den Anmeldern von Demonstrationen zum Thema [6].
Wie erwähnt: Die Erscheinung dieses heterogenen und diffus daherkommenden Protests beschränkt sich nicht allein auf das Einwirken solcher Kräfte, auch wenn Rechtsextreme unter ihnen immer wieder manifest sichtbar werden (vgl. Photo Nummer 4 [7]).
Die Frage wird jedoch sein, wie es um das Anliegen solches Protests bestellt ist, wenn es genau solche Kräfte anzieht?
(Übrigens, dass Nazis sich als Hüter von Verfassungsrechten aufspielen - ohne in Wirklichkeit welche zu sein -, ist nicht neu. Sofern es ihren politischen Interessen dient, sind sie natürlich dazu in der Lage. Dies traf selbst auf Adolf Hitler zu: Als die Brüning-Regierung vor der Reichspräsidentenwahl 1932 die Direktwahl des Präsidenten durch das Stimmvolk abschaffen und das Staatsoberhaupt durch die Parlamentarier wählen lassen wollte, spielte sich der NSDAP-Chef kurzzeitig als Verfassungshüter auf.
Hintergrund dafür war einfach, dass die NSDAP bei der letzten Reichtagswahl 1930 noch 18,3 Prozent der Stimmen erhielt, sich zwei Jahre später aber doppelt so viele Stimmen versprechen konnte. Wenn Nazis von Verfassungsrechten sprechen, meinen sie die eigenen, mitunter tun sie dies aber lautstark.)
Erste Abgrenzungen: Verschwörungstheorien, links und rechts
Wir werden uns an dieser Stelle nicht länger damit aufhalten zu versuchen, die Begrifflichkeiten "rechts" (und "links") als solche zu definieren - es mag dahingestellt bleiben, ob es sich um die bestmöglichen Wörter zur Bezeichnung der betreffenden Inhalte handelt, sie weisen jedoch auf eine zweihundert Jahre alte Begriffsgeschichte zurück.
Aus ihr und nicht aus abstrakten Überlegungen ergibt sich, in welchem Begründungszusammenhang welches Ideologieelement steht und wie eine ideologische Strömung einzuordnen ist.
Hingegen weisen Wörter wie "Verschwörungstheorie" und "-theoretiker" bereits einen höheren Definitionsbedarf aus, da sie nicht auf eine langjährige Verwendungsgeschichte zurückblicken und durch diese definiert werden; und auch, weil es die Gefahr zu bannen gilt, dass dieselben als schlichte Totschlagsbegriffe gar willkürlich eingesetzt werden.
Es sei also vorgeschlagen, als "Verschwörungstheorie" ein Gedankengebäude zu bezeichnen, das auf der Vorstellung fußt, gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge basierten im Kern auf einer Form von Geheimwissen, das bei eingeweihten Individuen angesiedelt ist. Und in dem nicht Strukturen von Herrschaft oder Ungleichheit analysiert und benannt werden, sondern in einzelnen Personen verankerte, abgrundartig böse Absichten zur Urquelle aller gesellschaftlichen Übel hochstilisiert werden.
Solche Vorstellungen tragen zur Zerstörung der Vernunft in der Auseinandersetzung mit einer, tatsächlich kritisier- und veränderbaren Gesellschaftsordnung (wie dem bestehenden Wirtschaftssystem) bei und unterminieren dadurch auch die Möglichkeit, zu tatsächlicher Veränderung zu gelangen, da letztere eine rationale Erkenntnis und Erklärung des Ist-Zustands voraussetzt.
Nein, Herrschaft, Ausbeutung und Ungleichheit basieren nicht auf dem irgendwie von Natur aus bösen Willen einzelner Individuen (nehmen wir rein zufällig: Bill Gates); erst recht nicht von Personengruppen, die man etwa über ihre gemeinsame Abstammung definieren könnte (wie in der antisemitischen Variante von Verschwörungsideologie, die zu ihren gefährlichsten Ausformungen zählt).
Herrschaft, Ausbeutung, Ungleichheit und Umweltzerstörung basieren auf gesellschaftlichen Gesetzesmäßigkeiten - etwa dem Zwang zur Selbstreproduktion von Kapital und dem Konkurrenzprinzip - die bestimmte ihnen vorausgehende menschliche Verhaltensweisen aufgriffen, um ein komplexes Gesellschaftssystem herauszubilden.
Dessen Funktionslogik kritisieren zu wollen, dafür gibt es gute Gründe. Dieses Gesellschaftssystem funktioniert jedoch nicht auf der Basis von Geheimwissen einzelner Individuen, dann hätte es nämlich längst zu funktionieren aufgehört. Materielle Fakten über die Verteilung und Wirkung von Macht in dieser Gesellschaft sind jedem und jeder zugänglich, viele davon kann man täglich beispielsweise im Wirtschaftsteil von Zeitungen nachlesen.
Diese Fakten werden den Mitgliedern der Gesellschaft nicht etwa vorenthalten, die den herrschenden Verhältnissen verpflichteten Medien verschleiern lediglich manche Gesamtzusammenhänge oder legen falsche Schlüsse aus den einzelnen Informationen nahe.
Rechter Protest und Sozialproteste
"Rechter Protest" ist im Unterschied etwa zu vom Solidaritätsprinzip getragenen Sozialprotesten ein solcher, der nicht möglichst universelle gesellschaftliche Interessen formuliert und mit möglichst vielen anderen menschlichen Interessen auszuhandeln versucht - sondern entweder brutal Partikularinteressen (auf dem Rücken anderer Menschen) durchzusetzen versucht und/oder diesen Versuch durch das Einsetzen verschleiernder Ideologen vernebelt.
Dabei kann eine soziale Basis für "rechte" Bewegungen durch ein Verknüpfen von Wahnvorstellungen, politisch instrumentierten Vorurteilen und Ressentiments einerseits und dem Appell an Partikularinteressen andererseits mobilisiert werden. Dies gilt für unterschiedliche Formen "rechter" Bewegungsdynamik und "rechten" Protests, die selbstverständlich nicht alle miteinander gleichzusetzen sind, sei es für den "Poujadismus" (eine vorwiegend mittelständische und gegen Steuern gerichtete, aber auch antisemitisch grundierte Protestformation in Frankreich), sei es für rassistische Proteste; sei es im Extremfall auch für eine Partei wie die NSDAP.
Letztere war eine Organisation, die eine klare ideologische Grundlage hatte - von der ein Gutteil in den Bereich der Wahnvorstellungen gehört -, die aber im Laufe ihrer Existenz unter anderem auch Anhänger und Anhänger mit vorwiegend wirtschaftlich motivierten "Protestwahlmotiven" anzog und dadurch erfolgreich wurde.
Im Gegensatz zu den "Arbeiterparteien" in der Weimarer Republik zog die NSDAP jedoch viel verzweifelte Kleinbürger an, denen nicht beispielsweise am Erreichen sozialer Grundrechte für alle gelegen war, sondern an ihrer eigenen Rettung in Zeiten wirtschaftlich bedrohter Existenz - was immer es für andere kosten möge.
Um einem leicht zu formulierenden Einwand gleich vorzubeugen: Nein, nicht jede "rechte" Bewegung ist mit der NSDAP gleichzusetzen. Und auch die derzeit erfolgreichen rechtsextremen Wahlparteien in Europa weisen zwar manchmal historische Bezüge auch zur letztgenannten auf (die FPÖ in Österreich hatte einen ersten Parteivorsitzenden nach ihrer Gründung, Anton Reinthaller, der von 1939 bis 1945 Staatssekretär unter Adolf Hitler und Abgeordneter im gleichgeschalteten Reichstag war), funktionieren jedoch in ihrem Alltag sicherlich nicht wie die NSDAP.
Und dies aus einem einfachen Grund, weil die historische Periode nicht mit den 1930er Jahren gleichzusetzen ist und eine genau wie die damalige NSDAP auftretende Partei in historischen Kostümen heute notorisch erfolglos bliebe (wie die oben genannte Kleinpartei "Die Rechte").
Strukturelle Gemeinsamkeiten zu benennen, ist wichtig, bedeutet jedoch auf keinen Fall Gleichsetzung: Es gibt heutzutage nichts, was mit der NSDAP wesensgleich wäre. Aber es gibt neofaschistische Parteien und Kräfte, die unter den Bedingungen des Jahres 2020 (nicht denen von 1922 oder 1933) um den ihnen heute möglichen Einfluss ringen. Solche Kräfte mischen aus ebendiesem Grunde mitunter in "rechten" Protesten mit.
Nicht jeglicher Protest gegen die Maßnahmen, die keineswegs nur in Deutschland, sondern in der Mehrzahl der Staaten der Welt in Konfrontation mit der Covid-19-Pandemie ergriffen wurden, ist in diesem Sinne "rechts".
Dies hängt auch damit zusammen, dass die vorgenannten Maßnahmen als solche ebenfalls nicht alle über einen Kamm zu scheren sind; unter anderem auch deswegen, weil sie eben nicht von einer gigantischen Verschwörerzentrale mit eindeutigen (abgrundtief bösen) Absichten gesteuert wurden, sondern weil in vielen Staaten die Exekutive wochenlang zwischen unterschiedlichen Optionen hin- und herschwankte.
Bis Anfang März 2020 glaubten viele Regierungen in Europa noch an eine mögliche "Herdenimmunität", was auch den Wirtschaftsverbänden sehr gelegen kam - dies trifft bekanntlich für die schwedische Regierung zu, auf fragwürdigen wissenschaftlichen Grundlagen [8] und um den Preis von vielen Toten [9] - anfänglich auch für die französische und die deutsche bis zu ihrem Umschwenken in der ersten und vor allem zweiten Märzwoche, die britische unter Boris Johnson brauchte dafür etwas länger.
Dann aber fürchteten sie einen nahenden Zusammenbruch der Krankenhausversorgung, während Donald Trump in Washington D.C. und Jair Messias Bolsonaro in Brasilia ohne Rücksicht auf Verluste den vorherigen Kurs weiterfuhren.
In der Mehrzahl der Fälle weisen die Corona-Maßnahmenpakete, möchte man vereinfachende Oberbegriffe auswählen, je einen "sozialen" und einen "repressiven" oder "polizeilichen" Maßnahmenzug auf.
Zum Erstgenannten zählen die Gewährleistung, dass Lohnabhängige sich in der Periode unmittelbarer Kontaminationsgefahr dem Arbeitszwang entziehen konnten und für die Dauer der akuten Krise eine Form von Erwerbsarbeit entkoppelten Einkommens (etwa durch Kurzarbeitergeld, das in Deutschland im Krisenverlauf von 60 auf 87 % des Vergleichslohns hochgesetzt wurde, in Frankreich beträgt es 84 %) ausbezahlt bekamen.
Die repressive Seite des Corona-Gesamtpakets
Zum Letztgenannten zählen hingegen polizeilich überwachte Ausgehverbote wie u.a. in Frankreich - in keinem deutschen Bundesland herrschten dabei vergleichbare strenge Regelungen wie im Nachbarland - und die, leider zu erwartenden und dann auch eintreffenden, diskriminatorischen oder rassistischen Begleiterscheinungen des Ganzen. Diese existierten etwa (jedoch nicht nur) in den Trabantenstädten [10], wie auch selbst die französische Regierungssprecherin einräumte [11].
Diese "repressive" Seite des Corona-Gesamtpakets der Exekutive war im Übrigen in der Bundesrepublik, wo individuelle Ausgänge im Unterschied zu Frankreich nie verboten waren, wesentlich weniger ausgeprägt als in vielen vergleichbaren Ländern (auch außerhalb Europas wie etwa Indien). Und das ursprüngliche Maßnahmenbündel war seit Anfang Mai längst einem Wettbewerb unter Bundesländern (etwa Bayern und NRW [12], Stichwort "Öffnungsdiskussionsorgien") über Öffnungsbeschlüsse gewichen, just zu einem Zeitpunkt, als die Protestdemonstrationen erst richtig in Fahrt kamen.
Linke, die sich gar zu gerne an einen solchen Protest "anhängen" würden in dem Glauben, gerade an dieser Front eine vermeintliche Tendenz zur Diktatur zu bekämpfen, sollten eine gute Erklärung dafür parat haben - vor allem sollten sie aufhören zu übersehen, dass zwar nicht der "repressive", jedoch sehr wohl der "soziale" Aspekt des Corona- Maßnahmenpakets gerade auch gegen massive Widerstände der mächtigsten gesellschaftlichen Kraft durchgesetzt werden musste, nämlich gegen die (organisierten) Kapitalinhaber. Von Letzteren ging ja auch ein Teil des Drucks auf eine schnellstmögliche "Öffnung" aus.
Eine Diktatur, die derart kurzfristig ausgerichtet ist und überdies noch konträr zu wesentlichen Interessen des Kapitals (dem ungehinderten Fortgang der Mehrwertproduktion!) steht, ist eine seltsame Diktatur.
Dies festzustellen, bedeutet nicht, dass nicht die massive Drohung im Raum stünde, in naher Zukunft Elemente der "polizeilichen" Seiten der Corona-Maßnahmen in den "Normalzustand" überführt zu sehen: Selbstverständlich trifft dies zu, und selbstverständlich werden die staatliche Exekutive und ihr Apparat dazu tendieren, manche nun in der Krise erprobten Instrumente auch für andere Zwecke in ihren Händen zu behalten (Überwachung, Versammlungsverbote…).
Dies gilt es aktiv zu bekämpfen. Das bedeutet aber nicht, alle Formen von Sondermaßnahmen zur Bekämpfung der Seuchenausbreitung abzulehnen; vielmehr gilt es bei ihren sozialen Schutzaspekten, den Druck des Kapitals zu ihrer Abschaffung zu kontern.
Notwendiges Unterscheidungsvermögen
Auf dem Solidaritätsprinzip aufbauende Sozialproteste oder Handlungen von Gewerkschaften im Namen der abhängig Beschäftigten oder auch von fortschrittlichen Juristinnen und Juristen, richteten sich in diesem Zusammenhang in vielen Ländern gegen den "repressiven" Aspekt des jeweiligen Maßnahmenbündels - und gegen ihn allein.
In Frankreich klagten bspw. zwei NGOs erfolgreich gegen die Drohnenüberwachung von Ausgangsbeschränkungen [13], die Anwaltskammer klagte gegen andere repressive Bestandteile des Regierungspakets. Als mehr oder minder fortschrittlich einzustufender Sozialprotest richtete sich jedoch nie gegen die Idee einer sanitären Notsituation als solche oder gegen jegliche Form von Sondermaßnahmen vor dem Hintergrund einer solchen Ausnahmesituation.
Völlig im Gegenteil wurde bei solchen Protesten mit sozialer Basis und/oder gewerkschaftlichen Aktivitäten stets gefordert, das sanitäre Risiko ernstzunehmen und deswegen noch mehr Menschen aus dem Arbeitszwang zeitweilig herauszuholen (vgl. zu Frankreich hier [14] und zum dort gefällten Amazon-Urteil [15] und zu Italien [16]).
Und die Regierung wurde etwa dafür kritisiert, dass sie sich wochen-, ja monatelang als völlig unfähig erwies, eine Versorgung der Bevölkerung mit einer ausreichenden Zahl von Mundschutz-Masken zu gewährleisten, was bis heute bleischwer auf Emmanuel Macrons Bilanz lastet und zum echten Legitimitätsdefizit wurde [17].
Ja, sanitäre Sondermaßnahmen hätte es im Übrigen mit einiger Wahrscheinlichkeit im fraglichen Zeitraum in, sagen wir, einer Räterepublik mit einer Wirtschaftsgrundlage des Selbstverwaltungssozialismus ebenfalls gegeben. (Andere als die real durch die bestehende Regierung, ergriffenen, einverstanden.) Denn auch radikale Linke hätten in einem solchen Fall, also in einem aus ihrer Sicht optimalen Gesellschaftssystem, mit dem objektiven äußeren Problem umgehen müssen.
(Auch wenn es neben anderen Menschen ebenfalls manche Linke geben mag, die das sanitäre Risiko gern sträflich verharmlosten oder unterschätzten. Ein Linksradikaler in älteren Jahren in Frankreich war nicht schlecht erstaunt und dann empört, als er junge Leute, die sich als Anarchisten ausgaben, zu Anfang der Corona-Krise im Pariser Raum unter dem aus dem Spanischen entlehnten Motto "Viva la muerte!" durch die Straße streifen sah. Wohl in der Annahme, einen selbst werde es aufgrund des jungen Lebensalters ja schon nicht treffen. Dies mag zweifellos mit Dummheit mehr zu tun haben als mit Anarchismus.)
Wie aber verhält es sich in diesem Zusammenhang mit den "Corona-Demonstrationen" in Deutschland?
Keineswegs wird, jedenfalls in der Mehrzahl der Fälle, eine vergleichbare Unterscheidung etwa zwischen Maßnahmen zum echten Schutz der Bevölkerungsmehrheit und rein repressiven oder aber bestehende Ungleichheiten - etwa für Obdachlose - verschärfenden Aspekten getroffen.
Im Gegenteil wird vielfach Wert darauf gelegt, just solche Maßnahmen zu attackieren, die wirklich zum Gesundheitsschutz beitragen wie das Verteilen von Mundschutz-Masken und die Verpflichtung zu ihrem Tragen (von der selbstverständlich Menschen mit Hautallergien oder anderen medizinischen Gegenindikationen auszunehmen wären).
Wenn das "Protestmotiv" darauf basiert, dass man sich selbst zu fein ist zum Anlegen eines Mundschutzes, diesen als "Maulkorb" [18]abtut, ja, wenn andere Menschen für sein Tragen aggressiv angemacht werden [19], dann ist die Sache definitiv sehr weit vom Solidaritätsprinzip entfernt.
Auch in einer von Antiautoritären regierten Selbstverwaltungsrepublik würden hier, mit Verlaub, in manchen Fällen die Handschellen klicken. Und Drittgefährdung ist kein Spaß.
Völlig zu schweigen von schlichtweg irren Äußerungen wie der öffentlich vorgetragenen Behauptung: "Das Virus existiert nicht!" [20] oder wahnwitzigen historischen Vergleichen mitsamt NS-Relativierung [21], selbst dann, wenn Letztere nicht die Hauptintention gebildet haben mag.
Textauszug aus diesem Essay (hier vollständig und mit den Anmerkungen)
Bernhard Schmid (48) ist hauptberuflich Rechtsanwalt in Frankreich und ansonsten seit über dreißig Jahren in antifaschistische Aktivitäten involviert. Mehrere seiner insgesamt circa zehn Bücher behandeln die extreme Rechte:
Die Rechten in Frankreich: Von der Französischen Revolution zum Front National (Deutsch)
Die Neue Rechte in Frankreich [80]
Distanzieren, leugnen, drohen. Die europäische extreme Rechte nach Oslo [81]
Datum: 22.04.2020 - aus: https://www.kontextwochenzeitung.de/debatte/473/die-argumente-der-coronaleugner-6673.html
Die Debatte über die Corona-Pandemie wird in linken Kreisen kontrovers, oft auch verbissen geführt. Die Gefahren des Virus werden relativiert oder bestritten oder in einen großen Plan gebettet. Unser Autor unterzieht ihre Argumente einer ernsthaften Prüfung.
1. Das Virus an sich.
Als sich die Corona-Epidemie immer stärker in Europa auszubreiten begann, im Februar und in den ersten zwei Märzwochen, wurde das Virus in linken Kreisen noch vielfach mit einer "etwas heftigeren Grippe" verglichen. Das hat sich inzwischen aufgrund des drastischen Anstiegs der Todesfälle erledigt und ist von einer anderen Rhetorik abgelöst worden. In der Partei Die Linke wurde die Debatte um demokratische Rechte jüngst mit dem Schlenker eingeleitet: "Unabhängig von der Gefährlichkeit des Corona-Virus, sehe ich die Gefahr ..." Auf "Rubikon" schrieb Jens Wernicke: "Solange alle an den Killervirus glauben und alles mitmachen, sieht es übel aus..." Doch was genau die "Gefährlichkeit" beziehungsweise den Charakter des Killervirus ausmacht – das geht in derlei Debattenbeiträgen, die so auch im wissenschaftlichen Beirat von Attac laufen, meist unter.
Zum Stand 21. April 2020 starben weltweit 175.000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Wie schnell sich das Virus ausbreiten kann, haben Virologen dutzendfach erklärt. Die Bundesregierung ließ bereits 2012/2013 in einer Risikoanalyse, die das Robert Koch-Institut (RKI) erstellte, vorrechnen, dass beim Auftreten eines solchen Corona-Virus – dort als "Modi-SARS-Virus" bezeichnet – "im gesamten zu Grunde gelegten Zeitraum von drei Jahren mit mindestens 7,5 Millionen Toten als direkte Folge der Infektion zu rechnen" sei (Bundestagsdrucksache 17/12.051, S. 64). Dabei ist logisch, dass die Grundannahmen eines theoretischen Virus' – Sterblichkeitsrate, Verbreitungsgrad, Inkubationszeit – nicht völlig identisch sein können mit dem nun tatsächlich auftretenden. Ein engagierter linker Journalismus müsste dennoch fragen, warum die Bundesregierung seither nochmals 120 Krankenhäuser geschlossen, Personal ausgedünnt und das RKI dazu die Klappe gehalten hat.
2. Von Vorerkrankungen und dem Alter der Toten.
Bei einem zweiten Topos in dieser Debatte wird direkt oder indirekt die Todesursache in Frage gestellt oder auf fatale Weise auf "das Alter" der Corona-Toten verwiesen. Die Plattform "Rubikon" hat dafür Fulvio Grimaldi aufgetrieben, der kritisiert, es werde nicht "zwischen Todesfällen mit COVID-19 und Todesfällen durch COVID-19 unterschieden". Der Autor konstatiert, dass es bei vielen der im Zusammenhang mit Corona Gestorbenen "bis zu drei schon vorher vorhandene schwere, ja sogar tödliche Krankheiten, neben einem Durchschnittsalter von über achtzig Jahren" gegeben habe: "Sie starben an Lungenentzündung, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Kollaps, zu denen dann die Grippe noch hinzukam." Aber haben nicht 95 Prozent der Menschen im höheren Alter "Vorerkrankungen"? Kritisieren wir nicht, dass in der Statistik der Straßenverkehrstoten solche nur dann aufgeführt werden, wenn diese binnen 30 Tagen nach einem Straßenverkehrsunfall aus dem Leben schieden? Danach sind es Tote in Folge von Herzinfarkt, Grippe, Diabetes.
Und wie kann es sein, dass ernsthaft das ALTER als eine Todesursache genannt wird – im obigen Zitat direkt, in anderen Fällen indirekt? Dazu schrieb der Schweizer Arzt Prof. Dr. Paul Robert Vogt in seinem bemerkenswerten, humanistisch argumentierenden Beitrag in der "Mittelländischen Zeitung" vom 7. April 2020: "Mit guter Lebensqualität ein hohes, selbstbestimmtes Alter zu erreichen, ist ein hohes Gut. […] Und es ist das Resultat der Medizin, dass man auch nach drei Nebendiagnosen bei guter Lebensqualität ein hohes Alter erreichen kann. Diese positiven Errungenschaften unserer Gesellschaft sind nun plötzlich […] nur noch eine Last. […] Gewisse Kommentare haben den üblichen Geruch der Eugenik."
3. Aber Schweden!
Die Zahl der Länder, die eine andere Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wählten, betrug bis vor kurzem noch ein Dutzend. Aktuell sind es nur noch wenige. Weißrussland und Brasilien zählen dazu. Doch damit will man sich als fortschrittlicher Mensch dann doch lieber nicht identifizieren. Auch wenn das Geschwätz, das es in diesem Zusammenhang gibt ("eine kleine Grippe" – Jair Bolsonaro; "eine Psychose", Alexander Lukaschenko) und die Strategie, die zur Anwendung kommt ("Herdenimmunität") einige Parallelen mit der hiesigen Debatte aufweisen. Es bleibt das "schwedische Modell" – das immerhin von einer sozialdemokratisch-grünen Regierung zu verantworten ist. Jetzt aber mal ernsthaft! Sind 1.765 Corona-Tote, Stand 21. April, ein Erfolg? Bei 10,3 Millionen Einwohnern? Was würden wir sagen, wenn es hierzulande – korrekt umgerechnet – 14.000 Corona-Tote geben würde (statt, Stand 21. April, 5.024)? Und wie kann es sein, dass in den Nachbarländern Norwegen und Dänemark, deren Bevölkerung jeweils nur ein Drittel so groß wie die schwedische ist, die Zahl der im Zusammenhang mit Corona Gestorbenen nur bei einem Fünftel (Dänemark; 364 Corona-Tote) beziehungsweise ein Zehntel (Norwegen; 181 Corona-Tote) liegt? Wobei diese Länder vergleichbar verfahren wie Deutschland. Doch so genau will man es dann doch nicht wissen.
4. Schuld ist der Gesundheitssektor.
Auf diese Aussage kann man sich als Linker leicht verständigen. Die Krankenhäuser wurden bekanntermaßen kaputtgespart. Dennoch ist das nur eine Teilerklärung. In einem Leserbrief auf den "Nachdenkseiten" wird zu Recht darauf hingewiesen, dass eine "ungehinderte Ausbreitung bis zur Herdenimmunität von 60-70 % (der Bevölkerung) jedes Gesundheitssystem überfordern und in Monaten Millionen Covid-19-Tote weltweit fordern" würde. Just solche Zahlen finden sich auch, siehe oben, in der Robert Koch-Institut-Studie aus dem Jahr 2013. Das deutsche Gesundheitssystem sieht aktuell noch stabil aus – doch warum? Vor allem deshalb, weil die Restriktionen, die von den Corona-Relativierern so wortreich beklagt werden, ein nicht zu bestreitendes Resultat hatten: Der Anstieg der Zahl der Infizierten wurde drastisch reduziert.
5. Was ist mit dem Straßenverkehr? Und Geflüchteten?
Verweise dieser Art sind äußerst problematisch. Ja, es gibt diese krasse Ungerechtigkeit der extrem unterschiedlichen Lebenswelten auf dem Planeten. Und ja, es muss das Ziel jeglichen von Humanismus geprägten Handelns sein, sich gegen diese Ungleichheiten aufzulehnen, einen Beitrag zu deren Abbau zu leisten oder zumindest über diese Zustände aufzuklären. Doch ein Aufrechnen, wie es in der aktuellen Debatte bei der Relativierung der Corona-Pandemie stattfindet, ist unsauber. Wir würden auch denjenigen kritisieren, der die tödlichen Folgen des Waffenbesitzes in den USA damit relativiert, dass er auf die nochmals brutaleren Folgen von Waffenbesitz in den brasilianischen Favelas verweist. Und wir würden denjenigen zusammenstauchen, der die 25.000 Straßenverkehrstoten pro Jahr in der EU relativiert, weil es weltweit Jahr für Jahr 400.000 Malaria-Tote gibt. Im Übrigen droht doch die folgende Kombination: In den Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln kann die Corona-Epidemie ausbrechen. Verweisen die Corona-Relativierer dann auch auf Vorerkrankungen? Auf das Alter von Corona-Toten? Darauf, dass das griechische Gesundheitssystem schuld sei?
6. Schutz der demokratischen Rechte.
Dieses Argument ist gewiss gut abzuwägen. Falsch ist jedoch, hier ein Entweder-Oder zu konstruieren, zu behaupten, es gelte konsequent die Grundrechte zu verteidigen. Punkt. Jede Einschränkung der Bewegungsfreiheit sei eine Einschränkung zu viel. Ein elementares Menschenrecht – wohl: das erste Menschenrecht – ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das Recht auf Leben. Dieses Recht wird durch die Pandemie für Millionen Menschen gefährdet. Und der aktuell einzig erhältliche, wirksame Schutz des Lebens dieser Menschen besteht in Einschränkungen bestehender demokratischer Rechte wie dem der Bewegungsfreiheit. Anstatt grundsätzlich die Monstranz demokratische Rechte vor sich herzutragen, muss ein humanistisch geprägter Journalismus darauf abzielen, aufzudecken, wie einseitig die demokratischen Rechte abgebaut werden, welche kapitalen Interessen da durchscheinen: Autohäuser wurden geöffnet, Kitas bleiben geschlossen. Im öffentlichen Leben gilt die 1,50-Meter-Distanz. Am Arbeitsplatz muss oft Schulter an Schulter gearbeitet werden.
7. Es droht das Böse – mindestens Orwell.
In der aktuellen Pandemie erhalten Verschwörungstheoretiker neuen Zulauf. Hinter all dem stecke ein großer Plan. Die WHO werde von Bill Gates finanziert. Das böse Virus stamme aus dem Reich des Bösen schlechthin, aus China. Amazon, Pharma und KI wären am Ende die Sieger.
Das ist platt und falsch. Es waren auch hierzulande die Herrschenden und die Mächtigen, die ein Laissez-faire praktizierten. Viel zu lange. Als die VR China, als Südkorea, als Singapur, als Taiwan mit rigiden Maßnahmen Erfolg hatten, befanden sie, einschließlich des RKI, das sei hier nicht nötig. Sprich, sie erkannten sechs Wochen lang nicht ihre Chance auf Demokratieabbau. Im Gegenteil: Am 15. März mussten diese Ignoranten noch unbedingt relativ demokratische Virenschleuder-Kommunalwahlen in Bayern und in ganz Frankreich durchführen.
Es war dann die schnell ansteigende Zahl der Corona-Toten, die dazu führte, dass endlich die restriktiven Maßnahmen ergriffen wurden. Wer verteidigt denn noch die Bewegungsfreiheit? Es sind Jair Bolsonaro, Donald Trump, Boris Johnson, Mark Rutte und Jörg Meuthen, also rechte Politiker. Sie tun dies nicht aus Verbohrtheit, sondern weil sie die Interessen der Wirtschaft, und zwar der kapitalistischen Wirtschaft, vertreten. In Italien war es der Industriellenverband Confindustria, der sich massiv gegen die Restriktionen wandte und für "Freizügigkeit" eintrat – und dagegen gab es Streiks der Beschäftigten, die zu Recht, mit Rücksicht auf ihr eigenes Leben und auf das Leben ihrer Familien, die bestehenden Restriktionen verteidigten.
Man schaue sich die Zahlen und Fakten an. Weltweit mussten bislang acht Billionen US-Dollar zur Stützung der Ökonomie ausgegeben werden. Weltweit wurden bisher mehr als 20 Prozent der Werte der an den Weltbörsen gehandelten Konzerne vernichtet. IWF und Weltbank rechnen mit einem Welt-BIP-Einbruch von mehr als vier Prozent, mit einem Rückgang der Wirtschaft in der EU um bis zu zehn Prozent. Die Lufthansa und der Autozulieferer Leoni (mit 100.000 Beschäftigten): beide fast pleite. Boeing: fast pleite. Das soll "Orwell" oder Finanzdiktatur oder ein "großer Plan" sein?
Der Knacks als Chance
Die Lage ist zunächst mal die, dass das System der Herrschenden einen massiven Knacks bekam. Dass im Oberstübchen der Gesellschaft massive Verluste entstehen und Kapital vernichtet wird. Dass die Eliten immer neue Rettungspakete schnüren müssen und doch erkennbar kopflos handeln. Dass sie sogar für Arbeitende, für sozial Schwache, für Mieter, für Kleingewerbetreibende Geld ausspucken, das wir vorher in diesen Dimensionen nicht für denkbar gehalten hätten. Klar: Das ist zu wenig! Klar: Sie reichen die fettesten Beträge an die fettesten Kapitalisten weiter. Dennoch: Sie versuchen, den Laden ruhig zu halten, da sie selbst Angst vor sozialen Bewegungen haben, die sich gegen sie richten könnten.
Wie diese Krise enden wird, weiß niemand. Doch in dieser Krise steckt auch eine Chance: Millionen Menschen erkennen, dass die bestehende Wirtschaftsweise fehlgesteuert ist. Dass ein großer Teil des Wirtschaftens (Rüstung, Auto, Flugzeugbau, Luftfahrt, Werbung) unnötig, wenn nicht zerstörerisch ist. Dass ein Umbau ("Konversion") von großen Teilen der Wirtschaft notwendig ist. Dass damit gewaltige Kapazitäten an gesellschaftlicher Arbeit frei würden – für Arbeitszeitverkürzung, höhere Einkommen der durchschnittlichen Bevölkerung, für sinnvolle Investitionen in Energiewende, Verkehrswende, Kultur und Bildung. Dass Solidarität neu entwickelt und eine neue solidarische Gesellschaft, in der Mensch, dessen Gesundheit, der Schutz von Umwelt und Klima im Zentrum stehen, anzustreben sind. Um ein solches Denken zu beflügeln, sollten wir gehörig Gehirnschmalz investieren.
Winfried Wolf ist Chefredakteur der linken Wirtschaftszeitung "Lunapark" und legt zum 1. Mai die neue Publikation "Faktencheck: CORONA – Die Solidarität in den Zeiten der Pandemie" vor. Unterstützt wird sie u. a. von Sabine Leidig, Heike Hänsel, Tom Adler, Werner Sauerborn und Volker Lösch. Sie kann jetzt schon bestellt werden unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Mehr zum Inhalt hier.
siehe auch diesen Zeitungsartikel, ein offener Brief eines Klinikleiters aus der Schweiz:
COVID-19 - eine Zwischenbilanz oder eine Analyse der Moral, der medizinischen Fakten, sowie der aktuellen und zukünftigen politischen Entscheidungen
GASTKOMMENTAR von Prof. Dr. med. Dr. h.c. Paul Robert Vogt
Über Postwachstum und Corona: Nico Paech (59) ist Volkswirt und der bekannteste Wachstumskritiker Deutschlands. Paech ist außerplanmäßiger Professor im Bereich Plurale Ökonomie an der Universität Siegen. Mitte März ist sein Buch „All you need is less“ über eine „Kultur des Genug aus ökonomischer und buddhistischer Sicht“ im Oekom Verlag erschienen.
In der Zwangspause vom Leistungsstress erkennen viele Menschen die Vorteile einer entschleunigten Gesellschaft, sagt Wachstumskritiker Niko Paech (27.04.20 - taz)
taz: Herr Paech, ist die Coronakrise eine Gelegenheit, das Wirtschaftswachstum und die damit einhergehende Umweltzerstörung dauerhaft zu bremsen?
Niko Paech: Ja, die Coronakrise ist eine Chance. Krisen decken Fehlentwicklungen auf: Die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern wie Atemschutzmasken oder Beatmungsgeräten erscheint plötzlich gefährdet. Unser Wohlstandsmodell entpuppt sich als verletzlich. Darauf können wir angemessen nur mit einer Postwachstumsstrategie reagieren.
Was bedeutet das?
Wir müssen auf Wirtschaftswachstum verzichten. Die deutsche Wirtschaft beispielsweise müsste weniger komplex und autonomer werden, damit im Krisenfall alle substanziellen Güter vor Ort hergestellt werden können. Eine Deglobalisierung mindert zwar die Kostenvorteile der entgrenzten Arbeitsteilung, stärkt aber die Stabilität. Das hat ökologische und soziale Wirkungen.
Welche?
Kürzere Wertschöpfungsketten lassen sich demokratischer und ökologischer gestalten, weil wir leichter auf sie einwirken können. Gleichwohl kann dies die Arbeitsproduktivität senken. Also steigen die Preise, während die Auswahl und die Produktionsmengen sinken, tendenziell auch die Löhne. Einfach weil Unternehmen dann die Produktion nicht mehr so leicht in spezialisierte Teilprozesse zerlegen und sie an die jeweils kostenoptimalen Standorte verschieben können. Dann werden die Menschen sich nicht mehr so viel leisten können. Die bessere Welt kriegen Sie nicht zum Nulltarif. Aber das bringt Krisenstabilität und neue Arbeitsplätze, wenngleich weniger im akademisierten als im handwerklichen Bereich.
Das werden Regierungen nur machen, wenn die Wähler zustimmen. Ist das zu erwarten?
Noch gibt es dafür keine Mehrheit. Aber die Coronakrise deckt für mehr Menschen auch Sinnkrisen auf. Viele Menschen leben nicht nur materiell, sondern auch psychisch über ihre Verhältnisse. Durch die Zwangspause vom Leistungsstress spüren sie, was ihnen zuvor verborgen blieb: Ein stressfreieres und verantwortbares Leben zum Preis von weniger Konsum- und Reisemöglichkeiten ist vielleicht gar kein schlechter Deal, zumal sich die Balance zwischen beidem austarieren lässt. Manche werden gar nicht mehr zurück ins Hamsterrad wollen, sondern möchten etwas von dem, was sie jetzt als Entlastung erleben, in die Post-Corona-Zeit hinüberretten.
Warum sind Sie eigentlich da so optimistisch?
Es mehren sich Erlebnisberichte darüber, wie Menschen die freigestellte Zeit genießen. Viele räumen auf, reparieren, arbeiten im Garten, lesen viel oder wenden sich Familienmitgliedern zu.
Ist es nicht wahrscheinlicher, dass viele Leute ihre jetzt unterdrückten Konsumwünsche nach der Krise erst recht ausleben?
Kann gut sein, dass sich manche in „Wohlstandstrotz“ üben werden. Aber von Krise zu Krise wächst der Anteil der Menschen, die sich dem Steigerungswahn verweigern und ökologischen Vandalismus missbilligen. Das kann neue gesellschaftliche Konflikte verursachen – aber ohne die wird es keinen Wandel geben.
Viele Eltern haben in der Coronakrise sogar mehr Stress, weil die Kinderbetreuung fehlt. Zahlreiche Menschen entwickeln Zukunftsängste. Kann daraus wirklich etwas Positives entstehen?
Früher oder später wird die Angst um die Überlebensfähigkeit unserer Zivilisation größer sein als die Angst vor dem Wohlstandsverlust, der sich zudem begrenzen und ertragen ließe. Aber je weniger Konsequenzen Richtung Postwachstumsökonomie gezogen werden, desto mehr gilt: Nach der Krise ist vor der Krise.
Heißt das: Je häufiger Krisen kommen, desto schneller gibt es eine Mehrheit für Degrowth?
Ja. Die Lehman-Brothers-Krise 2009 galt als schwerster Einbruch seit dem Schwarzen Freitag 1929. Jetzt sind gerade kaum mehr als zehn Jahre vergangen und eine noch schlimmere Krise breitet sich aus. Die Einschläge rücken näher. Lehman, Corona und die absehbar nächsten Krisen haben dieselbe Ursache: eine Lebensform, die auf blindwütiger Digitalisierung, Entgrenzung und Wohlstandsmehrung beruht. Weil diese Entwicklung weitergeht, sind die Ursachen der nächsten Krise bereits angelegt.
Inwiefern?
Im Wettbewerb um die Wählergunst überbieten sich Parteien darin, kurzfristig Symptome zu lindern, also alles, was nicht bei fünf auf den Bäumen ist, mit viel und billigem Geld zu übergießen, statt Strukturen so zu verändern, dass langfristig das Krisenrisiko sinkt. Insoweit dies auf Schulden basiert, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Finanzkrise. Es fehlt der Mut, eine Vermögensabgabe oder einen Lastenausgleich in Gang zu bringen, um diese Kosten durch Umverteilung zu finanzieren. Die Angst davor, dass dies Wählerstimmen kostet, ist noch zu groß.
Microsoft-Gründer Bill Gates sagt: Es wird zum Beispiel weniger Geschäftsreisen geben und dafür mehr Videokonferenzen. Gibt das Hoffnung?
Wenn Bill Gates das sagt, verbirgt sich dahinter die Hoffnung auf den Durchmarsch der Digitalisierung. Aber die Coronakrise ist gerade eine Krise der Digitalisierung.
Das Virus ist doch nicht über das Internet übertragen worden.
Ohne hinreichende Globalisierung des Personen- und Güterverkehrs wäre aus einer Epidemie keine Pandemie geworden. Und die entgrenzte Verflechtung zwischen Ländern beliebiger Entfernung, so auch zwischen China und Europa, ist ein Produkt der Digitalisierung – ganz gleich ob durch erschwingliche Direktflüge von Wuhan nach Italien oder intensive Wertschöpfungsbeziehungen. Nur kraft digitaler Medien konnte der bayerische Autozulieferer, bei dem der erste deutsche Coronafall festgestellt wurde, in China produzieren: Eine chinesische Webasto-Mitarbeiterin trug das Virus nach Deutschland. Die Digitalisierung ist zugleich Basis und Brandbeschleuniger aller Modernisierungskrisen.
In welchen Bereichen sollte die Globalisierung zurückgefahren werden?
Wenn Produkte, für die globale Lieferketten oder Verflechtungen in Kauf genommen werden, eines dieser vier Kriterien erfüllen, sollten sie im Inland erzeugt oder komplett vermieden werden. Erstens: Sie sind purer Luxus. Zweitens: Sie verursachen große ökologische Schäden. Drittens: Ihre Bereitstellung ist von sozialen Verwerfungen begleitet. Oder viertens: Sie sind so essenziell, dass ihre auswärtige Produktion zu kritischen Abhängigkeiten führt.
Konkret: Auf welche Produkte sollten wir verzichten?
Ein Leben ohne Mango, Kiwi, Avocado und Futterimporte für die Fleischindustrie zum Beispiel ist erträglich. Das gilt auch für Kreuzfahrten und Urlaubsflüge.
Warum nennen Sie Lebensmittel zuerst?
Es handelt sich um das substanziellste Grundbedürfnis. Außerdem verursacht die konventionelle Landwirtschaft aufgrund ihres globalen Verflechtungsgrades soziale und ökologische Verwerfungen: Landgrabbing, die Urwaldzerstörung für den Futtermittelanbau, die Überschwemmung afrikanischer Märkte mit Hähnchenteilen und vieles mehr. Weiterhin leisten wir uns den Luxus einer quasi Sklavenhalterwirtschaft, indem Fremdarbeiter aus Rumänien sogar eingeflogen werden, weil es unter der Würde junger Menschen in Deutschland ist, die für den Wohlstand nötige Arbeit selbst zu verrichten. Landwirtschaftliche Arbeit müsste wieder attraktiver werden – als Alternative zu Work and Travel und Akademisierungswahn.
Eine umweltfreundlichere Landwirtschaft setzt zum Beispiel weniger Pestizide ein. Deshalb werden mehr Arbeitskräfte etwa zum Unkrautjäten benötigt. Wie wollen Sie Leute motivieren, auf den Höfen zu arbeiten?
Die Attraktivität steigern würden angemessene Löhne und eine 20-Stunden-Woche, sodass Freiräume für andere, auch wissensintensive Aktivitäten entstehen. Zudem erhöht der ökologische Landbau die Sinnstiftung und Reputation der Arbeit.
Gerade haben wir kein Wachstum mehr – und die Arbeitslosigkeit steigt. Zeigt das, dass Degrowth schädlich ist für uns?
Auch für einen Bankräuber ist es schädlich, ihm die Beute zu entreißen. Unser Wohlstand resultiert nicht aus eigener Arbeit, sondern technologisch verstärkter Plünderung, bedürfte also ohnehin einer Korrektur. Arbeitslosigkeit kann durch eine verringerte Erwerbsarbeitszeit vermieden werden, sagen wir: 20 Stunden pro Woche. Daran ließe sich die wichtigste Maßnahme knüpfen, um soziale Verwerfungen zu vermeiden: nämlich Menschen unabhängiger von Konsumbedürfnissen werden zu lassen. Dies gelingt erstens durch mehr Genügsamkeit, die keinen Verzicht, sondern eine Befreiung von Reizüberflutung bedeutet: „All you need is less“ nennen mein Co-Autor Manfred Folkers und ich die neue Maxime. Zweitens sollte die Versorgung teilweise in eigenen Händen liegen, indem Produkte erhalten, repariert, mit anderen geteilt und auch selbst produziert werden. Eine Wirtschaft des Teilens und der Nutzungsdauerverlängerung – auch auf Basis neuer Märkte und Unternehmen – ist eine weitere Alternative zur krisenbehafteten Globalisierung.
Freuen Sie sich über den aktuellen Konjunktureinbruch?
Nein. Wachstumskritik sieht keine Schocktherapie vor, sondern eine sozial verträgliche Transformation.
Seite 10 von 16