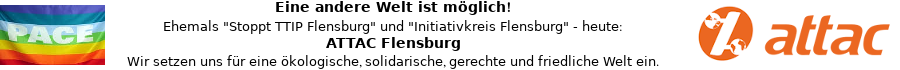Als friedenspolitischer Arbeitskreis der Deutschen Sektion der Internationalen Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW) fordern wir von der Bundesregierung eine neue Entspannungspolitik sowie die Förderung auch zivilgesellschaftlicher Aktivitäten zur Völkerverständigung mit Russland.
Und appellieren an die ganze Gesellschaft: Um einen Weg heraus aus der Eskalationsspirale und zur Beendigung des Ukrainekrieges zu eröffnen, greift es zu kurz, im Chor mit Regierung und Medien immer wieder einseitig nur den russischen Einmarsch in die Ukraine von 2022 anzuklagen, den auch wir als Bruch des Völkerrechts sehen. Vielmehr wenden wir uns klar gegen jede Form von Völkerrechtsbruch!
In Wahrnehmung der historischen Mission der IPPNW, der Verhütung des Atomkriegs, und der Kernziele des Leitbilds unserer deutschen Sektion, fordern wir daher:
- Der Ukrainekrieg kann und muss jetzt beendet werden – durch Respektierung nicht nur der ukrainischen, sondern auch der russischen Sicherheitsinteressen. Denn die weitere Eskalation dieses Krieges kann rasch in einen offenen Krieg der NATO mit Russland münden, und damit in einen Welt- und Atomkrieg!
- Dazu gehört zuvorderst die Abkehr von dem Plan, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, und die verbindliche und dauerhafte Festschreibung ihrer Neutralität.
- Sowie die Bereitschaft zu Kompromissen von beiden Seiten, auch von westlicher – etwa was den Status der Krim betrifft (als Basis der russischen Schwarzmeerflotte) sowie der Ostukraine mit ihrer überwiegend russischstämmigen Bevölkerung und Kultur.
- Sicherheit lässt sich in unserer von Atomwaffen und zunehmend auch von „künstlicher Intelligenz“ bedrohten Welt nicht durch gewaltsamen Ausbau der westlichen Dominanz, sondern nur gemeinsam herstellen: Sicherheit neu denken!
- „Gemeinsame Sicherheit“ heißt: Rückkehr zum Prinzip der Charta von Paris, in der zur Beendigung des Kalten Krieges 1990 festgeschrieben wurde: „Sicherheit ist unteilbar, und die Sicherheit jedes Teilnehmerstaates ist untrennbar mit der aller anderen verbunden.“
- Dies bedeutet auch die Einsicht, dass Sicherheit in unserer modernen Welt, in der uns die Zerstörungspotenziale der Waffen längst über den Kopf gewachsen sind, nicht durch weitere Vergrößerung dieser Potenziale herstellbar ist, sondern nur durch ein neues Denken, das Kommunikation und Vertrauensbildung an die erste Stelle setzt.
Bewährte Formate wie die UN und die OSZE sind hierfür zu reanimieren und zu stärken. - Rückkehr zum Völkerrecht – die UN-Charta gilt für alle, für Russland wie auch für den Westen!
- Respektierung und Förderung der Multipolarisierung der Welt durch nicht-militärische Bündnisse wie die BRICS statt gewaltsamer Erhaltung der westlichen Hegemonie. Insbesondere hat die NATO nichts in Ostasien zu suchen – schon allein der NATO-Vertrag widerspricht diesen Plänen, denen jetzt eine klare Absage zu erteilen ist.
Auch die BRICS-Initiativen zur Beendigung des Ukrainekrieges sind uns willkommen! - Rückkehr auch zum Rüstungsbegrenzungs- und -kontrollregime, mit dem der Kalte Krieg beendet wurde – vor allem:
Rettung des New-Start-Vertrages über die Reduktion der strategischen Atomwaffen, der andernfalls Anfang 2026 ersatzlos ausläuft;
Wiederbelebung des 2019 von Trump gekündigten INF-Vertrages, der Mitteleuropa von den atomaren Mittelstreckenwaffen befreit hatte, statt Stationierung neuer US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland 2026;
Beitritt Deutschlands zum Atomwaffen-Verbotsvertrag (TPNW), statt die in Deutschland stationierten US-Atomwaffen für Milliarden aus Steuergeldern zu modernisieren. - Hilfreich für die Vertrauensbildung sind auch zivilgesellschaftliche Aktivitäten wie Städte-, wissenschaftliche und kulturelle Partnerschaften, die durch die „Zeitenwende“ gecancelt wurden – hier ist ein Umdenken und eine schrittweise Wiederherstellung erforderlich.
Das beschriebene Umdenken wird nicht nur die Bedrohung der Welt durch Krieg, Atomkrieg und Völkermord eindämmen, das Klima schützen und Millionen von Menschen vor Flucht und Vertreibung bewahren. Sondern es wird auch unserem eigenen Land ganz direkten Gewinn bringen: Denn der Wegfall der ruinösen Hochrüstung für 5% des BIP, die Mittel in der Höhe von fast 50% des Bundeshaushalts verschlingt und dazu Berge von Zinsen, die für BlackRock & Co. bestimmt sind, wird Geld für Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Eisenbahn und Klimarettung freisetzen, die unser Land so dringend braucht.
Erläuterung dieser Initiative:
Ein ernsthafter Ansatz zur Beendigung des Ukrainekrieges erfordert zuallererst eine Umkehr des Denkens:
Zum einen die Erkenntnis, dass Kriege fast immer am Verhandlungstisch enden.
Sowie die Bereitschaft, unsere eigene, westliche Rolle bei der Herbeiführung des Konflikts zu sehen: Indem wir die Verletzung der russischen Sicherheitsinteressen durch die wortbrüchig seit Jahren vorangetriebene NATO-Ostexpansion erkennen. Und vor allem, indem wir diesen Kurs jetzt korrigieren, indem die NATO und ihre führenden Mitgliedsstaaten incl. Deutschlands, die Aufnahme der Ukraine in die NATO endlich ausschließen, und zwar dauerhaft.
Die Idee, mittels des Putsches von 2014 die westliche Hegemonie auf die Ukraine auszudehnen und die Krim als Standort der russischen Schwarzmeerflotte dem NATO-Territorium einzuverleiben – mit dem Ergebnis, die Ukraine in einen Pro-EU-/NATO-Teil und einen pro-russischen Teil zu spalten – hat sich als katastrophaler Fehler erwiesen.
Hinzu kam der Bruch des Minsk-II-Abkommens durch Präsident Selenskyjs Dekret Nr. 117 von 2021 zur Rückeroberung von Krim und Donbas – was der Westen tolerierte, ja förderte.
Sowie die vertane Chance von Istanbul gleich zu Beginn des Krieges, ihn mit einem Kompromissfrieden zu beenden – dem die NATO bei ihrem Brüsseler Gipfel im März 2022 eine Absage erteilte – bekräftigt durch die Entsendung von Boris Johnson nach Kiew, um Selenskyj von der Unterzeichnung abzuhalten.
Die Wiederherstellung des zerstörten Vertrauens in westliche Zusagen erfordert nun ein Aufgreifen der positiven Signale aus den USA durch ein klares Verständigungsangebot an Russland auch seitens des europäischen Teils der NATO einschließlich Deutschlands.
Und die Abkehr vom Kurs der „Kriegstüchtigkeit“, also der horrenden Vergrößerung der bereits bestehenden konventionellen NATO-Überlegenheit (siehe Greenpeace-Studie 2024) –
der mit der Steigerung der Rüstungsausgaben von 2% auf 5% des BIP verfolgt wird sowie
mit der Aufstellung von US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland, die Angriffs- und Erstschlagswaffen sind und Moskau fast keine Vorwarnzeit mehr lassen.
Die Begründung dieser Eskalationsstrategie in hiesigen Medien und Talkshows – Russland plane bis 2029 einen Angriff gegen die NATO – widerspricht allen Fakten:
– Jenseits propagandistischer Phrasen ist kein Interesse Russlands an einem solchen Angriff erkennbar. Sämtliche US-Geheimdienste haben 2024 und 2025 derartige Pläne verneint.
– Zudem ist Russland militärisch nicht annähernd in der Lage, einen Krieg gegen die NATO zu führen. Laut SIPRI-Daten und der darauf basierenden Greenpeace-Studie von 2024 ist Russland konventionell selbst dem europäischen Teil der NATO weit unterlegen.
Beide Fehler – NATO-Ostexpansion samt der immer noch unkorrigierten Parole, der Weg der Ukraine in die NATO sei „unumkehrbar“ (Rutte) sowie die neue NATO-Massivrüstung – befeuern die in Russland zunehmende Befürchtung, westeuropäische Mächte würden – wie schon mehrfach in der Geschichte – erneut einen Angriffskrieg gegen Russland planen.
Hinzu kommt der westliche Völkerrechts-Nihilismus, der sich seit 1999 in den westlichen Angriffskriegen gegen Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien manifestiert. Sowie die Kündigung zentraler Rüstungskontrollabkommen und die Missachtung von Verträgen durch die USA. In Russland wird bereits diskutiert, ob die USA überhaupt vertragsfähig sind.
Aktuelle Beispiele für die Doppelmoral des Westens sind das genozidale Vorgehen in Palästina, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen den Iran und die fortgesetzte Unterstützung der rechtsextremen israelischen Regierung mit Geld und Waffen durch die USA und Deutschland. Seine „Drecksarbeit“-Äußerung im deutschen Fernsehen zu Netanjahus Vorgehen offenbart die Geringschätzung des Bundeskanzlers für das Völkerrecht.
Russland zur Einhaltung des Völkerrechts zu bewegen, erfordert die Rückkehr zum Völkerrecht auch durch den Westen – anstatt es durch dessen sogenannte „regelbasierte Ordnung“ zu ersetzen.
Der historische Fehler liegt nicht in der alten Entspannungs- und Verständigungspolitik, die bekanntlich zur Überwindung des Kalten Krieges und der Blockkonfrontation führte. Sondern in der Abkehr davon zugunsten westlichen Vormacht- und Expansionsstrebens wie der NATO-Ostexpansion, das ein Grundprinzip der Charta von Paris ignoriert:
„Sicherheit ist unteilbar, und die Sicherheit jedes Teilnehmerstaates ist untrennbar mit der aller anderen verbunden.“
Daher:
Abkehr vom Feindbild Russland – für eine neue Entspannungspolitik!
Berlin, 04.12.25
Donald Trumps offener Imperialismus stellt die EU-Regierenden vor ein exquisites Problem
Stephan Kaufmann - nd-Woche, vom 09. Januar '26
Mit dem Angriff auf Venezuela und der Entführung seines Präsidenten hat sich die US-Regierung den Vorwurf eingehandelt, das Völkerrecht zu brechen. An Donald Trump dürfte dieser Vorwurf abprallen. Schließlich demonstriert der US-Präsident mit dem Fall Venezuela erneut, dass sich seine Regierung an internationale Vereinbarungen nicht gebunden sieht. Mehr Probleme mit der Anklage des Völkerrechtsbruchs hat dagegen die EU. Denn sie legitimiert ihre Geopolitik regelmäßig mit dem Völkerrecht – genau das soll sie von anderen Weltmächten unterscheiden. Trump zwingt die EU daher nun in einen »Balanceakt zwischen geopolitischen Realitäten und rechtsstaatlichen Grundsätzen«, erklärt die »Frankfurter Rundschau«. Europa will schon, so die Botschaft, aber kann leider nicht. Warum nicht?
Gemessen an ihren »rechtsstaatlichen Grundsätzen« fielen Europas Erklärungen zum US-Angriff sehr verständnisvoll aus. »Die EU teilt die Priorität der Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und des Drogenhandels, die weltweit eine erhebliche Sicherheitsbedrohung darstellen«, ließ die Hohe Vertreterin der EU, Kaja Kallas, kurz nach dem US-Angriff verlauten. Die EU rufe alle (!) Akteure zu Ruhe und Zurückhaltung auf, um eine Eskalation zu vermeiden. »Unter allen Umständen« müssten die Grundsätze des Völkerrechts gewahrt werden, schickte Kallas hinterher – allerdings ohne die USA zu nennen.
Ähnlich klang es aus Europas Hauptstädten: »Nicolás Maduro hat sein Land ins Verderben geführt«, erlärte Bundeskanzler Friedrich Merz. »Die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes ist komplex. Dazu nehmen wir uns Zeit.« Frankreichs Präsident Emmanuel Macron frohlockte, das »venezolanische Volk ist heute von der Diktatur Maduros befreit worden und kann sich nur freuen«. Laut Großbritanniens Premier Keir Starmer »unterstützt das Vereinigte Königreich seit Langem einen Machtwechsel in Venezuela«. Und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte, sie halte die US-Operation zur Bekämpfung des Drogenhandels für »legitim«.
Legal dürfte sie allerdings nicht gewesen sein. Verletzt haben die USA laut Expertenmeinungen offensichtlich eine ganze Reihe von Normen: Artikel 2 und 51 der Charta der Vereinten Nationen, Artikel 9 und 14 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte, die UN-Resolutionen 2625 und 3314, Artikel 8 des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs und die Charta der Organisation Amerikanischer Staaten. In den sozialen Medien hagelte es daher Kritik an der EU. Der Journalist Dave Keating diagnostizierte ein »außenpolitisches Totalversagen«. Europas Staats- und Regierungschefs »weigern sich, die Schwere des Geschehens anzuerkennen«.
Die EU braucht die USA, um eine imperiale Macht zu bleiben, die sich gleichzeitig gegen die USA behaupten will.
Erklärt wird diese Weigerung meist damit, die EU sei gegenüber den USA in einer schwächeren Position und daher erpressbar. Allerdings ist bemerkenswert, dass ökonomisch und politisch deutlich schwächere Regierungen vor Kritik an den USA nicht zurückschreckten. So zeigte sich zum Beispiel die Regierung von Ghana »alarmiert durch die unilaterale und nicht autorisierte Invasion der Bolivarischen Republik Venezuela durch die Vereinigten Staaten«. Man sei »erinnert an die koloniale und imperialistische Ära«.
Die Reaktion einer Regierung auf das US-Vorgehen ist also offenbar keine Frage ihrer ökonomischen oder politischen Stärke. Sondern eine Frage ihrer Interessenlage. Und in diesem Sinne brauchen die Europäer die USA dringender als Ghana sie braucht. Denn für die EU und ihre Mitgliedsstaaten geht es derzeit um die Frage, inwieweit sie überhaupt noch den Status einer Weltmacht haben. Und für diesen Status brauchen sie die Rückendeckung der USA.
Zum Beispiel in Lateinamerika, wo die EU immer weiter abgedrängt wird. Lag ihr Anteil am Außenhandel der Mercosur-Staaten (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay) im Jahr 2000 noch bei 31 Prozent, so erreichte er im Jahr 2023 gerade einmal 15 Prozent. Größter Handelspartner Südamerikas ist inzwischen China. Um den Trend zu drehen, hat die EU mit dem Mercosur ein Freihandelsabkommen vereinbart, das Europa in Sachen Handel und Rohstoffe unabhängiger von China und den USA machen soll. Nach zahlreichen Verzögerungen soll es nächste Woche unterschrieben werden.
Ob das klappt, ist unsicher, ebenso wie die Haltung Washingtons. Denn laut ihrer neuen Nationalen Sicherheitsstrategie wollen die USA ihre »Vorherrschaft in der Westlichen Hemisphäre wiederherstellen« und zu diesem Zweck »Wettbewerber« daran hindern, dort »strategisch wichtige Güter zu kontrollieren«. Stattdessen will Washington selbst die Kontrolle ausüben: Gelingt der Zugriff auf das venezolanische Erdöl und finden sich Geldgeber für seine Förderung, dann stehen 30 Prozent der globalen Ölreserven unter dem Einfluss Washingtons, errechnet die US-Bank JPMorgan Chase. »Diese Verschiebung könnte das Kräfteverhältnis auf den internationalen Energiemärkten neu gestalten.«
Für die EU geht es also darum, Washington davon zu überzeugen, dass Europa beim Projekt der Sicherung der Westlichen Hemisphäre ein Partner der USA ist und kein »Wettbewerber«. Auch davon hängt der Status der EU als Welthandelsmacht ab, aus dem ihre politische Macht resultiert.
Angewiesen auf das Wohlwollen der US-Regierung ist die EU aber vor allem in ihrem Verhältnis zu Russland. Der Rückzug der USA aus der Ukraine-Hilfe, Trumps Verhandlungen mit Russland und die Drohung Washingtons, die militärische Unterstützung Europas komplett einzustellen, hat in der EU zwar zu dem Bemühen geführt, sich unabhängiger von den USA zu machen. Allerdings sind die Europäer absehbar nicht in der Lage, ihre weitreichenden geopolitischen Interessen ohne die US-Unterstützung durchzusetzen – geschweige denn gegen die USA. »Europa wird nicht gegen die USA kämpfen und ist nicht in der Lage, die Nato aufzugeben«, kommentierte Wolfgang Münchau von der Denkfabrik Eurointelligence. »Die Abhängigkeit der EU von den USA ist absolut.«
Europas Aufrüstung dient daher weniger seiner Emanzipation von den Vereinigten Staaten, sondern dazu, für die USA und innerhalb der Nato ein unverzichtbarer Partner zu werden. Im Gegenzug hoffen die Europäer auf Anerkennung ihrer Interessen durch Washington – insbesondere bei der Erweiterung der EU um die Ukraine, Moldau und den Westbalkan, der laut EU-Kommission »derzeit wichtigsten geostrategischen Investition der EU«.
Diese Anerkennung wurde diese Woche von Washington mal gewährt, dann wieder verweigert. Zunächst hieß es am Dienstag, die USA stellten sich als Schutzmacht hinter eine europäische Überwachung eines Waffenstillstands in der Ukraine. Bundeskanzler Merz bedankte sich: »Wir brauchen eine starke amerikanische Unterstützung, um das Engagement Europas zu sichern«. Am Donnerstag wiederum meldeten Medien, die US-Regierung habe ihre Zusage zurückgezogen.
Vor diesem Hintergrund mahnte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, man solle in Sachen Venezuela kein »vorschnelles Urteil treffen und damit in Streit mit dem US-Präsidenten geraten, den wir ja gewinnen wollen«. Zur Vorsicht riet auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Armin Laschet (CDU). »Außenpolitik ist kompliziert. Man muss den Realitäten in der Welt Rechnung tragen«, sagte er im Sender »RBB«. Eine »einseitige Anklage gegen US-Präsident Donald Trump« würde voraussichtlich zu einem Einflussverlust in der Ukraine-Politik führen.
Die scharfe Reaktion der Regierung von Ghana lässt also darauf schließen, dass das Land die USA als imperiale Macht fürchtet. Die EU dagegen braucht die USA, um eine imperiale Macht zu bleiben, die sich gleichzeitig gegen die USA behaupten will. Also lässt Europa die US-Regierung in Sachen Venezuela gewähren. Das ruiniert zwar seinen – bereits durch den Gaza-Krieg angeschlagenen – Ruf als Schutzherr des Völkerrechts und macht Europas Gründe zweifelhaft, die es für die Unterstützung der Ukraine anführt.
Doch können sich Europas Regierende auf die Rückendeckung durch ihre Öffentlichkeitsarbeiter verlassen: Das Völkerrecht »hat die Weltpolitik noch nie so bestimmt, wie man sich das hier in Sonntagsreden vorstellt«, erklärt die »FAZ«. »Einem Despoten wie Maduro muss man keine Träne nachweinen.« Und ein Vergleich von USA-Venezuela mit Russland-Ukraine sei sowieso unangebracht, so der Journalist Nikolaus Blome. Schließlich »ist es ein Unterschied, ob eine Diktatur eine Demokratie überfällt oder eine Demokratie einen Diktator abräumt«. Diesen Unterschied hat die EU schon einmal anerkannt: 1999 bei der Bombardierung Serbiens durch die Nato – die ebenfalls nicht durch das Völkerrecht gedeckt war.
Der vorliegende Text entstand im September 2025 aus den Diskussionen der ATTAC-Kampagnengruppe „Rohstofenergiehunger stoppen“. Er wurde am 28.9. im Attac-Rat diskutiert.
Zweck dieses Textes ist es nicht, eine umfassende oder gar vollständige Analyse aktueller Tendenzen der (De-)Globalisierung zu leisten. Es geht vielmehr darum, einen Diskussionsprozess zu initiieren, um zu klären,
* welche Veränderungen die Weltwirtschaft aktuell bestimmen, insbesondere ob die Generalbeschreibung „Globalisierung“ noch zutrifft,
* ob es erkennbare, nachvollziehbare Erklärungen aktueller Phänomene gibt oder ob wir es zunächst mit eher zufälligen Ereignissen zu tun haben,
* ob es dabei möglich ist, Prioritäten für die politische Bearbeitung der Situation zu bestimmen,
* ob Attac über die Kapazitäten (politisch-inhaltlich, personell, finanziell) verfügt, eine solche Bearbeitung anzugehen,
* ob sich dafür Bündnisstrukturen bestimmen ließen und ob wir diese nutzen können.
Der Text entsteht aus Überlegungen in der Kampagnengruppe RohstoffEnergieHunger stoppen. Wir waren uns schnell einig, dass Analysen, wie sie uns noch vor einem Jahr gültig erschienen, angesichts neuester Entwicklung unzureichend und unvollständig sind, auch wenn nicht alles daran falsch ist. Im folgenden greife ich (Werner Rätz) einige inhaltliche Punkte auf, die bei unseren Diskussionen eine Rolle spielten. Konkrete Formulierungen und politische Gewichtungen stammen dabei von mir, auch wenn einiges in der Kampagnengruppe ähnlich gesehen wird.
1. Die (staatlich betriebene) Energiewende ist mindestens ausgebremst, und zwar nicht nur in Ländern mit rechtsradikaler Regierung(sbeteiligung), sondern auch bei den angeblichen Vorreitern wie Deutschland. Der Green Deal der EU-Kommission scheint am Ende, Verordnungen/Gesetze wie CRMA zumindest zumindest insoweit obsolet, als sie nicht mehr alleine die strategische Agenda bestimmen.
* Damit hängen auch alle Projekte, die darauf beruhten, wie das Namibia-Wasserstoffprojekt, Rohstoff- und Energiepartnerschaften, Umnutzungsüberlegungen für EU-nahe oder -eigene Gaspipelines, in der Luft.
* Was „der Markt“ hier noch leisten kann und wird, bleibt abzuwarten. Technikoptimisten wie Rico Grimm https://www.cleantech.ing/ oder Institutionen wie IRENA https://www.irena.org/News/pressreleases/2025/Jul/91-Percent-of-New-Renewable-Projects-Now-Cheaper-Than-Fossil-Fuels-AlternativesDE erwarten da fast Wunderdinge und tatsächlich war ein großer Teil des Aufschwungs der Erneuerbaren marktgetrieben.
-
Die sogenannte Dekarbonisierung als Ziel (europäischer) Politik war in diesem Zusammenhang immer schon eine Irreführung.
* Es ging den früh industrialisierten Ländern nie um den Ersatz von Kohle oder fossilen Energieträgern allgemein in größerem Ausmaß, sondern zentrales Element ihrer Strategie war die Nutzung von „Senken“, das heißt die Auslagerung der Folgen ihres Tuns in die arm gemachten Länder des Südens (und Ostens).
* Zusätzlich setzt die offizielle globale Klimapolitik, auch der UN-Konferenzen und -Wissenschaftler*innen, auf sogenannte „technische Lösungen“ wie CO2-Abscheidung.
* In dem ganzen Szenario ist obendrein der gesamte militärische Bereich schon aus der Betrachtung ausgenommen gewesen, als von „Ukraine“, „Gaza“ noch gar keine Rede war. Diese und kommende akute Kriege verschärfen diesen Aspekt noch einmal in einem mangels Daten nicht quantifizierbaren Umfang.
* Dagegen muss jede auch nur im Ansatz ernst zu nehmende Politik, die planetare Grenzen beachten will, auf die umfassende Reduktion von Energie- und Stoffverbrauch bestehen. Die fossilen Energieträger müssen in der Erde bleiben.
* Wie die daraus entstehenden Belastungen global zu verteilen sind, muss ausgehandelt werden, darf aber die notwendige Verbesserung der Lebensverhältnisse der arm Gemachten nicht behindern.
-
Im Ausbau der Erneuerbaren spielt China die herausragende Rolle, allein 40 Prozent des jüngsten Zubaus gehen auf seine Kappe, genau so viel wie auf die aller Industrieländer zusammen. Danach folgen Indien und Brasilien mit jeweils fast 10 Prozent.
* Man darf das aber nicht missverstehen: China verfolgt kein Modell einer Energiewende, sondern eines der beschleunigten Industrialisierung mit Verbreiterung seiner Energiebasis und Erhöhung seiner Gesamtenergieproduktion.
* Das scheint genau der Aspekt zu sein, den Indien (jüngst) und Brasilien (schon länger) kopieren. Ob andere Länder dazu ebenfalls das Potenzial hätten (Pakistan ließ zuletzt Anstrengung dahingehend erkennen, andere BRICS könnten ebenfalls bestrebt sein) bleibt zu prüfen (s. u.).
* Die chinesische Industriepolitik umfasst Bemühungen um eine gezielte „Entwicklung“ von Kunden und Märkten. Zwar betreibt das Land keinerlei uneigennützige Außenwirtschaftspolitik, aber es behandelt die Partnerländer in der Belt and Road Initiative nicht als reine Rohstofflieferanten, sondern es bemüht sich, dort finanziell potente Sektoren aufzubauen, die Teil des eigenen kapitalistischen Universums werden könnten. Das erinnert eher an Marshallplan als an Neokolonialismus.
-
Die Rückkehr (fast) nur zu den Fossilen ist eine in vieler Hinsicht unsinnige Strategie, sie ist
* ökologisch desaströs
* ökonomisch zu teuer (Erneuerbare sind fast immer deutlich billiger als Fossile, so IRENA, s. o.)
* industriepolitisch zu eng, weil sie zu wenig Energie für industriell-digitale Offensiven zur Verfügung stellt.
* Unabhängig von der Frage des Potenzials einiger Länder für solche (beschränkten) Offensiven stellt sich auch die Frage, wer deren politischen und ökonomischen Träger sein könnten. Gibt es in der Türkei, in Indonesien, in Südafrika, in Mexiko u a. (Gegen-)Eliten, die ein solches Projekt tragen und durchsetzen könnten? Das allgemeine Einknicken vor Trumps Zolldrohungen lässt eher Zweifel aufkommen.
-
Die Technologieentwicklung ist zwar ebenfalls mit großen Fragezeichen verbunden, aber absehbar scheint, dass manche Erwartungen aus der jüngsten Vergangenheit sich so nicht erfüllen werden. Lithium wird nicht das „weiße Öl“ und Wasserstoff nicht das „grüne Gas“ werden.
* Trotzdem werden strategische Metalle weiterhin extrem bedeutsam sein und der Zugang zu ihnen ein Aspekt bleiben, der die Bedeutung eines Landes im internationalen Machtgefüge mit bestimmt. Der Versuch, zumindest Teile der jeweiligen Wertschöpfungsketten im eigenen Land zu halten, wird nach wie vor attraktiv sein und Machtpotenziale beinhalten.
* Darauf könnten industrie- und andere strategischen Bündnispolitiken aufsetzen, durchaus auch in begrenztem Umfang in Süd-Süd-Kooperationen. Allerdings ist da bisher nicht viel mehr zu sehen als die erweiterten BRICS.
-
Ohnehin begrenzte Ressourcen werden durch die Vielzahl der Begehrlichkeiten und die steigende Menge strategischer Rohstoffe, aber auch durch ihre zunehmend schwierigere Sicherung (s. u.) noch knapper, insbesondere die Welternährung wird in absehbarer Zeit mit industrieller Landwirtschaft nicht mehr zu sichern sein. Bodendegradation, Schädlingsausbreitung, Seuchen, Umweltvergiftung fordern ihren Tribut.
* Dabei sind durchsetzungsfähige Träger*innen für eine umfassende Agrarwende, wie sie sogar die Weltbank für unausweichlich hält (https://www.weltagrarbericht.de/), weit und breit nicht in Sicht.
* Das macht das Sterbenlassen und perspektivisch auch das Sterbenmachen zu einer realen Option, die allerdings umfassend nur genutzt werden kann, wenn die Bereitschaft und Fähigkeit zum Führen (ungleichgewichtiger) Kriege vorhanden ist.
-
Die allerdings werden immer leichter führbar, weil
* Länder, insbesondere in der Migrationsabwehr (s. u.), dazu offensiv angeleitet werden (Türkei, Libyen, Mexiko),
* ohne Kriege selbst begrenzte Einflusssicherungen kaum noch gelingen,
* rein „handwerklich“ Kriege partiell wieder einfacher werden (Drohnen),
* Industrialisierung perspektivisch zu Rüstungsproduktion führen muss (Ernest Mandel: Mehr Industrialisierung geht nur, wenn ein immer größerer Teil des Gesamtprodukts in die Produktion von Produktionsmitteln (Maschinen) fließt, die wiederum auf Dauer nur ausgelastet werden können, wenn sie Zeugt produzieren, das im Nu wieder entwertet wird.). Diese Tendenz ist in China, Japan, Indien deutlich zu sehen.
-
Die Sicherung des materiellen Überlebens wird im Kapitalismus damit immer ungewisser. Subjektive, politisch unmittelbar beeinflussbare Umstände wie Ausgrenzung z. B. durch Krieg oder Rassismus, ebenso wie objektive, nur mittelfristig zu verändernde Bedingungen wie fehlende Nahrungsgrundlagen oder lebensfeindlich werdende Umwelten kommen hier zusammen.
* Durchgängig reagieren Bewegungen weltweit darauf mit der Forderung, die Garantie des unmittelbaren Überlebens als gesellschaftliche Aufgabe zu verstehen und nicht mehr dem (Arbeits-)Markt zu überlassen. In den letzten Jahren habe sich so unterschiedliche Autor*innen wie die Nobelpreisträger*innen Abhijit Banerjee/Esther Duflo, der Club of Rome oder der DIW-Präsident Marcel Fratzscher für die (globale) Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens ausgesprochen.
* Interessant ist dabei besonders die Argumentation der feministischen Ökonomin Bengi Akbulut. Sie verweist darauf, dass „die Entkoppelung der Bedürfnisbefriedigung vom Erwerbsstatus … nicht nur den Zwang zur Arbeit in ausbeuterischen, entfremdenden und entwürdigenden Beschäftigungsverhältnissen aufheben“ würde, sondern „auch den Zwang beseitigen, das Wirtschaftswachstum wegen seines Potenzials, Arbeitsplätze zu schaffen, aufrechtzuerhalten“ (https://www.jstor.org/stable/pdf/jj.12865310.19.pdf?addFooter=false).
* Konsequent zu Ende gedacht ergibt sich damit grundsätzlich die Gleichung Arbeitsplätze = Wachstum = Krieg, auch wenn die Realität langsamer ist, als eine solche Formulierung nahezulegen scheint.
-
Politische Trägerin des fossilen Rollbacks wie der antisozialen und reaktionären Politikwende ist die (radikale) Rechte. Dabei kommen deren tendenzielle faschistoide und ihre (neo-)liberale Strömung zusammen.
* Das gelingt nicht nur deshalb besonders leicht, weil der Neoliberalismus praktisch versagt und theoretisch völlig abgewirtschaftet hat, sondern auch deshalb, weil mit Feminismus- und Ausländerfeindlichkeit zwei kulturell verbindende Elemente vorliegen.
* Aber man darf sich nicht täuschen: Hier geht es nur vordergründig um (reaktionäre) „Kultur“, Migration und Feminismus sind tatsächlich die Hauptgegnerinnen des reaktionären Gewaltregimes.
* In der Migration zeigt sich der individuelle Überlebenswillen, der alle Ressourcen und Netzwerke nutzt, um scheinbar vorgezeichneten desaströsen Schicksalen zu entgehen. Dabei stört sie, die Migration, das Gewaltregime in der Regel mehr, als dass sie tatsächliche Alternativen aufzeigt.
* Das tut allerdings der Feminismus, wenn auch eher in seiner südlichen, Schwarzen oder Farbigen Variante als in der bürgerlich-weißen. Kaum irgendwo findet sich noch ein umfassender neuer Gesellschaftsentwurf, in den feministischen Mobilisierungen und Organisierungen großer Bewegungen in den arm gemachten Ländern des Südens aber sehr wohl.
Die Welt war fair, bevor der Russe losschlug: Das ist das Weltbild des deutschen Buchhandels – gemessen an den Friedenspreisen seit 2022. Warum jemand ausgezeichnet werden sollte, der uns den Imperialismus erklärt. Und wer das sein könnte
Von Oliver Schlaudt,Daniel Burnfin, Velten Schäfer
Er sei ein „hochklassiger Muskelprotz für das Big Business“ gewesen, „für die Wall Street und die Banker, (…) ein Gangster, ein Verbrecher für den Kapitalismus“. Harte Worte, und es geht weiter: „Man hat unseren Jungs, die in den Tod geschickt wurden, schöne Ideale vorgegaukelt (…). Niemand hat ihnen gesagt, dass es in Wirklichkeit um Dollars und Cents ging.“
Ähnliches könnte wohl jeder Soldat über fast jeden Krieg sagen. Aber Smedley Butler, aus dessen 1935 erschienenem Manifest War is a Racket diese Sätze stammen, war nicht irgendein Soldat. Und die Kriege, in denen er kämpfte, sind zwar vergessen, waren aber trotzdem nicht irgendwelche Kriege. Butler ist bis heute der einzige Soldat der US-Streitkräfte, der zweimal mit der höchsten Auszeichnung dekoriert wurde, der Medal of Honor. Die Einsätze, in denen er sich diese verdiente, markieren den Anfang einer Ära und eines Systems, das bis heute so fest im Sattel sitzt, dass es viele gar nicht mehr als solches erkennen: des Imperialismus à la USA.
Als Butler seine Orden verdiente, war das in einer Hinsicht ähnlich: Die Operationen, in denen sich der Marine-Infantrist auszeichnete – die Besetzung des mexikanischen Hafens Veracruz 1914 und der Überfall auf Haiti 1915, dem zwanzig brutale Besatzungsjahre folgen –, zeigten zwar aller Welt, dass hier eine neue Macht aufstieg, die nicht zögerte, ihre Macht- und Wirtschaftsinteressen mit Kanonenbooten durchzusetzen. Doch die alten Imperien Europas, die sich gerade zu zerfleischen begonnen hatten, brauchten noch Jahre, um zu verstehen, dass sie ausgespielt hatten, die Besiegten wie die Sieger.
Karl Schlögel nimmt Putin ins Visier
Und heute? Ist dieser „Imperialismus“ allenfalls Schnee von vorgestern. Das behauptet zumindest die amerikanische Historikerin Anne Applebaum. In ihrem Buch Die Achse der Autokraten wischt sie nicht nur über hundert Jahre revolutionärer, linker oder auch nur humanistisch-liberaler Imperialismuskritik vom Tisch, sondern gleich den ganzen Begriff.
So etwas wie eine systematische, herrschafts- und nötigenfalls auch gewaltförmige Asymmetrie im Weltsystem gibt es ihr zufolge gar nicht, nur einen Kampf von Gut gegen Böse. Andere prominente Stimmen kennen zwar noch den Begriff, entkleiden ihn aber jeder systemischen Ebene: „Imperialismus“ ist dann nur noch eine negative Charaktereigenschaft von politischen Führern oder gleich ganzen „Kulturen“.
Man ahnt, wer gemeint ist: „Die Russen sind Barbaren, sie sind gekommen, um unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Bildung zu vernichten“, charakterisiert der ukrainische Dichter Serhij Zhadan in Himmel über Charkiw die „imperiale Kultur“ Russlands. Der Historiker Karl Schlögel nimmt jüngst eher den Präsidenten persönlich ins Visier: „Getrieben und überwältigt von Hass“ sei dieser, „gepeinigt von einer Kränkung und einem Komplex“, der aus ihm herausbreche: „Die unbewältigte Geschichte des untergegangenen Imperiums, dessen (…) Wiedererrichtung als Drittes Imperium er (...) betreibt“ – so schreibt er in einem Sammelband, der Wladimir Putin in eine Reihe von „Tyrannen“ von Nero über Ivan den Schrecklichen bis Augusto Pinochet stellt.
Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht an Kriegsideologen
Zhadan, Applebaum und Schlögel haben nun eins gemeinsam: Sie sind in dieser Reihenfolge Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in den Jahren 2022 bis 2025. Bemerkenswert ist daran nicht nur, dass diese Auszeichnung, die früher gern Persönlichkeiten verliehen wurde, die für Versöhnung, Dialog und Deeskalation standen, zum dritten Mal in Folge an Verfechter einer maximalistischen Kriegsagenda geht. Nimmt man diesen Preis als das, was er sein will – das jährliche Statement der deutschen Geisteswelt zur politischen Lage des Planeten –, stimmt es bedenklich, wie naiv wir Dichter und Denker in eine Zukunft zu stolpern scheinen, die womöglich von tiefgreifenden Umbrüchen im Weltsystem geprägt sein wird.
Schon deshalb ist es geboten, den Imperialismus als Systembegriff wieder freizulegen. Das ist aber kaum möglich, ohne die führende Macht zu benennen, die das entsprechende Instrumentarium geschaffen hat. Diese Macht sind – allen möglichen Verschiebungen in näherer Zukunft zum Trotz – bis heute die Vereinigten Staaten von Amerika, die mit 750 Militärbasen in 80 Staaten präsent sind und ihre Währung als globale Leitwährung installiert haben.
Dass das mitunter in Vergessenheit zu geraten scheint, liegt auch daran, dass die USA sich bei der Erlangung und Verteidigung ihrer globalen Dominanzposition als höchst flexibel und kreativ erwiesen haben. In Washington wurde der Imperialismus sozusagen mehrfach neu erfunden – bis hin zu einem Punkt, an dem er in den Augen vieler schlicht unsichtbar wurde.
Die erste dieser Überraschungen war nach dem Ersten Weltkrieg in London und Paris zu verdauen: Nachdem die USA – durch genau die Art von protektionistischer Wirtschaftspolitik, die sie bis heute anderen Ländern zu untersagen versuchen – eine rasante Industrialisierung durchlaufen und mehr noch als durch direkte Kampfeinsätze durch ihre Waffenlieferungen den Abnutzungskrieg in Europa entschieden hatten, wurde nun ungerührt die Rechnung präsentiert: Die ab 1917 gelieferten Kriegsmittel seien selbstverständlich zu bezahlen! Die kriegserschöpften Siegermächte Frankreich und England saßen also plötzlich auf astronomischen Verbindlichkeiten. Den besiegten Feind Deutschland behandelte Washington hingegen eher rücksichtsvoll – wohl um es als Gegenspieler von England benutzen zu können und Letzteres noch mehr zu schwächen.
Die USA hätscheln den offiziellen Feind und demütigen ihre Verbündeten. Der zu Selbstbewusstsein erwachte Adler „spreizte seine Klauen“, wie es Michael Hudson 1972 in seinem noch immer lesenswerten Buch 'Super Imperialism' beschrieb. Mit „Super-Imperialismus“ meinte er ein präzise definiertes Phänomen. Anders als im klassischen europäischen Imperialismus, der in diesen Weltkrieg geführt hatte, ist es nicht mehr das private Kapital, das den Staat dazu drängt, ihm gewaltsam neue Märkte zu öffnen. Im Gegenteil agierte die amerikanische Regierung hier mit ihren eigenen finanziellen Mitteln und konsolidierte die Vorherrschaft der USA, indem sie Konkurrenten in die Position von Schuldnern bringt.
Im 20. Jahrhundert nahm diese Geschichte viele Wendungen, die den kaltblütigen Pragmatismus amerikanischer Regierungen zeigen. Der Zweite Weltkrieg spülte Unmengen Gold in die USA. 60 bis 65 Prozent der globalen Goldreserven lagen 1945 in ihren Tresoren. Die USA nutzten diesen Hebel: Mit dem Abkommen von Bretton Woods wurde der Dollar an das Gold gekoppelt und somit zur globalen Leitwährung. Zugleich entwarfen die USA mit den Institutionen des Internationalen Währungsfonds (IWF), der Weltbank und des General Agreements on Tariffs and Trade die globale Finanz- und Wirtschaftsarchitektur, die in der Nachkriegszeit den weltweiten Freihandel voranbringen sollte.
60 bis 65 Prozent der globalen Goldreserven lagen 1945 in den Tresoren Federal Reserve
Auch wenn die USA – rund 400 Militärinterventionen zwischen 1776 und 2023 zeugen davon – auf eine Kanonenbootpolitik wie zu Smedley Butlers besten Zeiten nie verzichtet haben, ist dies eine ganz neue Art von Dominanz. Die Vereinigten Staaten beginnen, ihre Vorherrschaft hinter einem vordergründig allgemeingültigen und neutralen Regelwerk zu verstecken. Dessen Herrschaftsförmigkeit zeigt sich freilich darin, dass die USA niemals vorhatten, sich selbst an irgendeine dieser neuen Regeln zu halten. In IWF und Weltbank haben sie eine Sperrminorität. Das Freihandelsabkommen GATT – 1996 von der Welthandelsorganisation WTO abgelöst – trieb Washington zwar maßgeblich voran, ratifizierte es selbst aber nie. Handelspartner sind so zum Freihandel gezwungen, während die USA sich jederzeit Marktschließungen vorbehalten.
Wie schwer es den „Partnern“ fiel, dieses System zu verstehen, zeigte sich 1971 in spektakulärer Weise. Plötzlich kündigten die USA das Bretton-Woods-Abkommen de facto. Die teure globale Militärpräsenz – besonders die Kriege in Korea und Vietnam – hatte die Vereinigten Staaten vom internationalen Gläubiger in einen internationalen Schuldner verwandelt. Also entschied Präsident Richard Nixon, jene Konvertibilität des Dollars in Gold abzuschaffen, die die Grundlage für die ökonomische Nachkriegsarchitektur gewesen war.
Die Vereinigten Staaten beginnen, ihre Vorherrschaft hinter einem vordergründig allgemeingültigen und neutralen Regelwerk zu verstecken.
Wie wenig etwa die bundesrepublikanische vox populi diese Wendung begriff, zeigte eine Karikatur in der Süddeutschen Zeitung, die einen ökonomischen Selbstmord der USA suggerierte. Als etwas klüger erwies sich der prominente Journalist Diether Stolze – später Helmut Kohls Wirtschaftsberater – in der Zeit. Zwar sah auch er eine Panikreaktion, aber er beobachtete korrekt: „Nixon möchte nicht mehr die Amerikaner für die Stabilisierung bezahlen lassen, sondern das Ausland.“
Tatsächlich verlagerte die Schließung des Goldfensters das Risiko der Dollarabwertung auf ausländische Zentralbanken, die große Dollarreserven hielten, aber nun keinen Anspruch mehr auf amerikanisches Gold erheben konnten. Was sich aber auch Stolze nicht vorstellen konnte, war, dass diese Politik den USA mehr als nur eine Atempause verschaffen könnte. Tatsächlich aber hatte Washington entdeckt, dass sich die Welt genauso gut als globaler Schuldner kontrollieren ließ wie zuvor als globaler Gläubiger. Die USA bezahlten ihre Militärpräsenz und damit ihre Machtbasis nunmehr mit Papiergeld, das die ausländischen Regierungen wohl oder übel annehmen mussten, um ihre eigenen Dollarreserven nicht zu entwerten. So übernahm die Welt die Kosten dafür, sich von den USA beherrschen zu lassen.
Die USA bezahlten ihre Militärpräsenz und damit ihre Machtbasis nunmehr mit Papiergeld
Hier kehrt sich also, wie schon Michael Hudson erläutert, die Funktionsweise des klassischen Imperialismus um, wobei das Ergebnis dasselbe bleibt: die Gewinnung von Ressourcen in Form von Renten aus dem Rest der Welt durch finanzielle Mittel und mit militärischer Unterstützung. Ziel der USA ist nun nicht mehr, anderen ihre Exporte aufzudrücken, also überschüssige Rohstoffe, Güter und Kapital. Vielmehr versuchen sie heute, als der größte Nettoimporteur, den Rest der Welt als Nettoexporteure dazu zu bringen, Zahlungen für reale Güter in einer Währung zu akzeptieren, die durch nichts gedeckt ist.
Damit bleibt allen anderen nur eine Option: der Kauf amerikanischer Aktien und Staatsanleihen, sprich Schuldscheine für noch mehr Dollar. Die imperialistische Maschine läuft nun bilanztechnisch umgekehrt, aber mit umso größerer Wirkung: Die Vermögensbesitzer in den USA eignen sich den Reichtum der Welt an, die dafür nichts bekommt als Papier und Zahlen in einer Bilanz. Es zahlt sich für die USA wirklich aus, die Welt mit ihrer globalen Reservewährung und 750 Militärstützpunkten auf der ganzen Welt zu dominieren.
Das war ein Geniestreich – mit günstigen Nebenwirkungen. Denn auch viele Kritiker der USA verstehen nicht, dass für diese nun ganz eigene Regeln gelten. Ständige Abgesänge auf die „hochverschuldeten“ USA, die demnächst als Weltführungsmacht abdanken müssten, sind nicht nur Wunschdenken, sondern tragen auf ihre Weise zu einer Dethematisierung der amerikanischen Weltdominanz bei.
Trumps Zollpolitik steht in einer Tradition
Wider Willen ergänzt sich hier eine begriffslose Kritik mit der vollkommen naiven Weltsicht, die dergestalt beschaffene „regelbasierte Weltordnung“ sei eine zivilisatorische Errungenschaft der „Weltgemeinschaft“ – sowie mit einem Vasallenstolz, der die nachgeordnete Mitwirkung in diesem System als Privileg und moralische Verpflichtung verstehen will.
Und geradezu als Booster der Normalisierung und Moralisierung dieses funktional invertierten, aber höchst effektiven Imperialismus wirkt nunmehr die landläufige Verdammung Donald Trumps: Indem etwa seine Zoll-Erpressungspolitik geradezu als zivilisatorischer Bruch bejammert wird, erscheint der vorhergegangene Zustand systematischer herrschaftsförmiger Asymmetrie als die gute alte Zeit. Dabei zieht Trump nur einen Pfeil aus dem Köcher, den sich die USA stets aufgehoben hatten: Wenn beiderseitiger Freihandel uns einmal nicht nützlich erscheint, können wir jederzeit auf Einbahnstraße umschalten!
Damit haben wir ein Modell dafür, was wir heute unter Imperialismus verstehen müssen: Imperialistisch ist ein Land, das seine Interessen kennt und so konsequent wie rücksichtslos verfolgt. Es betrachtet andere grundsätzlich nicht als gleichberechtigte Partner, sondern immer nur als Hebel des eigenen Vorteils. So etabliert es eine globale Hegemonie, die nicht nur politisch den Ton angibt, sondern sich auch den größten Teil des globalen Reichtums sichert, während es die Kosten der Herrschaft auf die Beherrschten abwälzt.
Niemand außer den USA kommt auch nur in die Nähe einer solchen imperialistischen Machtfülle – natürlich auch Russland nicht, selbst wenn Putin wirklich davon träumen sollte. Für den Bestand dieser Macht ist es auch zweitrangig, ob der 2008 verkündete Plan, die NATO bis an die russische Grenze auszudehnen, in den Gräben des furchtbaren – wenn auch nicht „genozidalen“ – Ukraine-Krieges steckenbleibt. Die derzeitige „Lösung“, in der sich Westeuropa und Russland gegenseitig schwächen, während die Ukraine blutet und die USA kassieren, erinnert nicht zufällig an die US-Politik nach dem Ersten Weltkrieg.
Damit haben wir ein Modell dafür, was wir heute unter Imperialismus verstehen müssen: Imperialistisch ist ein Land, das seine Interessen kennt und so konsequent wie rücksichtslos verfolgt.
So ist es verfrüht, wenn etwa Marc Saxer von der Friedrich-Ebert-Stiftung anlässlich amerikanischer Absetzbewegungen von der Ukraine im IPG-Journal resümiert, „der Hegemon“ habe „die von ihm geschaffene und über Jahrzehnte garantierte liberale Weltordnung für obsolet erklärt“. Tatsächlich ist die US-Dominanz alive and kicking, wie man in den Staaten sagt. Nervös machen würde Washington etwas anderes: Wenn die sogenannten BRICS-Staaten die Mittel gewännen, ihre bislang utopische Drohung mit einer zum US-Dollar alternativen Leitwährung umzusetzen.
Und zweitens zeigt die verharmlosende Rede von einer „liberalen Weltordnung“, der nunmehr eine „Wolfsgesellschaft“ zu folgen drohe, wie dringend eine kritische Öffentlichkeit eines erneuerten Imperialismusbegriffs bedarf. Denn die Ordnung, die wir hier hauptsächlich in ihrer polit-ökonomischen Funktionsweise zu skizzieren versuchten, ist ja wolfsmäßig genug.
Blickt man über die Kernstaaten des „Westens“ hinaus, ist von einer Pax Americana kaum eine Spur. Es zeigt sich eine lange Reihe an Kriegen und „Interventionen“, an bewaffneten Auseinandersetzungen, die nur im Spannungsfeld des imperialistischen Verhältnisses zu verstehen sind, und viel strukturelle Gewalt – von wirtschaftlichem Zwang über politische Entrechtung bis zu Armut und Hunger.
Der Fall Venezuela zeigt, wie schwer es ist, sich dem Imperium zu entziehen
So muss man dem Nobel-Komitee dieser Tage ironisch danken für die Vergabe seines „Friedenspreises“ an die venezolanische Politikerin María Corina Machado. Ja, die Partei der politischen und ökonomischen Hardlinerin wurde 2024 wohl um einen Wahlsieg gebracht. Machado war aber 2002 auch am Putsch gegen den gewählten Präsidenten Hugo Chávez beteiligt und drängte 2019 auf eine außerkonstitutionelle Absetzung von Nicolás Maduro.
Nun hat sie die Auszeichnung umgehend Trump gewidmet, der zugleich vor der Küste „Drogenboote“ versenkt und Kanonenboote versammelt. Der Fall Venezuela zeigt, wie schwer es ist, sich dem Imperium zu entziehen: Dieses kann jederzeit ein solches Maß an wirtschaftlichem und politischem Druck aufbauen – erst von außen, dann von innen –, dass isolierte Ausbruchsversuche tatsächlich oft im Griff zu repressiven Mitteln enden. Wäre etwa Burkina Faso strategisch wichtiger, stünde Präsident Ibrahim Traoré längst im Fokus.
Es gibt einen bösen Satz von Henry Kissinger, dem Doyen der US-Weltdominanz: „Amerika hat keine Freunde, es hat Interessen. (...) Ein Feind der USA zu sein, ist gefährlich, ein Freund zu sein, ist tödlich.“ Geht es weiter wie zuletzt, könnten wir bald erleben, was das bedeutet. Durch seine aggressive Exportorientierung nahm Deutschland im beschriebenen Post-Bretton-Woods-System eine Sonderposition ein. Unter den europäischen Vasallen war es der Primus und konnte einen guten Teil der Tribute nach unten durchreichen, etwa in Form von nach Südeuropa exportierter Arbeitslosigkeit. Doch damit scheint nun Schluss zu sein, nicht zuletzt durch den Wegfall billigen Erdgases.
Zwei Dinge sind wichtig, um dieses böse Erwachen angemessen zu verarbeiten: Putin trifft ausnahmesweise keine Schuld – und Imperialismus ist doch etwas mehr als jene Diktatoren-Propaganda, von der Anne Applebaum spricht. Sollte der deutsche Buchhandel für seinen Friedens-Schild einmal jemanden suchen, der all das erklären kann, steht ein Kandidat längst bereit: Jener Michael Hudson, von dem hier mehrfach die Rede war. Sein einschlägiges Werk zum Super-Imperialismus müsste freilich zunächst übersetzt werden. Freiwillige vor – es lohnt auch ohne Friedenspreis!
Oliver Schlaudt lehrt Philosophie und Politische Ökonomie an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz. Daniel Burnfin lehrt Germanic Studies an der University of Chicago. Velten Schäfer ist Redakteur des Freitag
EU-Kommission billigt Freihandelsabkommen mit Mercosur-Staaten
Das EU-Mercosur-Abkommen ist keine Alternative. Dessen Umsetzung wäre ein Frontalangriff auf Klimaschutz, Biodiversität und Menschenrechte. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.
Die EU-Kommission hat am vergangenen Mittwoch die Texte für das EU-Mercosur-Abkommen veröffentlicht. Was bezeichnend ist: Sie will den Abstimmungsmodus nachträglich ändern. Dem verhandelten Assoziierungsabkommen müssen eigentlich alle EU-Mitgliedsstaaten zustimmen. Mit einem Verfahrenstrick soll der Abstimmungsmodus nachträglich geändert werden. Statt eines einstimmigen Beschlusses sollen die Regierungen nun den Wirtschaftsteil durch vorläufige Anwendung mit qualifizierter Mehrheit in Kraft setzen.
Die Kritik und das Nein einzelner Staaten wird damit de facto außer Kraft gesetzt
Die Kritik und das Nein einzelner Staaten wird damit de facto außer Kraft gesetzt. Völkerrechtler Markus Krajewski kam vor einigen Monaten in einem juristischen Gutachten zu dem Schluss, dass eine vorläufige Anwendung des Abkommens gegen das ursprüngliche Verhandlungsmandat verstößt und ohne neues Mandat durch den Rat rechtswidrig sei.
Behauptet wird, dieses Abkommen sei die richtige Reaktion auf Trumps Protektionismus. Dabei wird übersehen, dass das Wirtschafts- und Handelssystem, bei dem der Markt über allem steht, gescheitert ist. Das Wohlstandsversprechen für alle durch neoliberales Wirtschaften ist ein Märchen, das nicht eingelöst wurde. Die Logik des Marktes und der Konkurrenz führte gerade zum Erstarken rechter autoritärer Akteure wie AfD und Trump.
Das EU-Mercosur-Abkommen ist keine Alternative. Dessen Umsetzung wäre ein Frontalangriff auf Klimaschutz, Biodiversität und Menschenrechte. Keines der kritisierten Probleme im Vertrag, die immer wieder von Landwirt:innen, indigenen Gemeinschaften, Klimaaktivist:innen und anderen Teilen der Zivilgesellschaft benannt wurden, wurden gelöst.
Das EU-Mercosur-Abkommen ist keine Alternative
Ein Wirtschaftsmodell mit seiner Wachstumslogik, für das dieses EU-Mercosur Abkommen steht, ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die planetaren Grenzen systematisch überschritten werden, es führt, wenn wir so weiter wirtschaften, unweigerlich in eine Katastrophe.
Der Multilateralismus ist auch an dieser Konkurrenzlogik gescheitert. Eine Welt, die für alle eine Lebensperspektive schaffen will, und darum sollte es uns gehen, geht aber nur im multilateralen Rahmen, solidarisch und gemeinsam. Was wir benötigen, sind Abkommen, die eine Strategie der Kooperation umsetzen, die Klimaschutz und Menschenrechte ins Zentrum rücken.
Der Autor ist Handelsexperte des globalisierungskritischen Netzwerkes Attac.
Seite 1 von 17