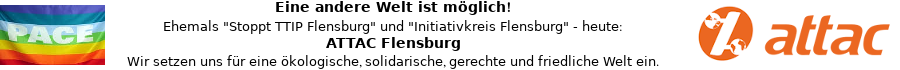Eine Buch- und Diskussions-Empfehlung
Ulrich Brand und Markus Wissen analysieren in ihrem Buch die imperiale Lebensweise und ihre Konsequenzen. Sie beruht darauf, dass ihre zerstörerischen Folgen auf andere Regionen der Welt verlagert werden.
Eine markante Ausdrucksform dessen, was Ulrich Brand und Markus Wissen „imperiale Lebensweise“ nennen, offenbart sich, wenn Mann oder Frau im Rohstoffe und Sprit fressenden SUV (Sports- and Utility-Vehicle) zum Biobauern fährt und zugleich ein gediegenes Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein zeigt. Der Begriff verweist darauf, dass das alltägliche Leben in den kapitalistischen Zentren nur durch den unbegrenzten Zugriff auf die Rohstoffe, das Arbeitsvermögen und die Ökosysteme in der Peripherie ermöglicht wird – mit der Folge, dass sich dort Gewalt, Entwurzelung, Hunger, Seuchen, Epidemien, ökologische Zerstörung und politisch-gesellschaftliches Chaos ausbreiten.
Die „imperiale Lebensweise“ beruht auf einer Art gesellschaftsstabilisierendem Kompromiss zwischen den Interessen der Herrschenden und breiteren Schichten der Bevölkerung. Die sie kennzeichnende Art des Produzierens und Konsumierens ist tief in das allgemeine Bewusstsein, die alltäglichen Verhaltensweisen und die Subjektprägungen eingeschrieben. Sie beruht darauf, dass ihre zerstörerischen Folgen auf andere Regionen der Welt verlagert werden.
Diesen Zusammenhang anzusprechen ist zwar nicht ganz neu, in der politischen Debatte und im allgemeinen Bewusstsein spielt er allerdings bestenfalls eine Nebenrolle. Das Verdienst der Autoren besteht darin, die damit verbundene Problematik weit ausgreifend, theoretisch gut begründet und mit empirischem Material unterlegt aufzuzeigen.
Das beginnt mit einer Kritik der aktuellen Debatte, in der oft von der Notwendigkeit einer „großen Transformation“ die Rede ist, das zugrundeliegende Problem, nämlich die kapitalistische Vergesellschaftungsweise aber überhaupt nicht thematisiert wird. Es folgt eine ausführliche Skizze der historischen Entwicklung vom frühen Kapitalismus und Kolonialismus bis zum Fordismus in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und zur als „Globalisierung“ bezeichneten neoliberalen Offensive. Dabei setzen die Autoren die umwälzende Dynamik des Kapitalismus in Verbindung mit den sozialen Kämpfen um eine Verbesserung der Lebensbedingungen.
Einen Höhepunkt erreicht dies laut Brand und Wissen im Fordismus, der durch eine Verbindung von Massenproduktion und Massenkonsum gekennzeichnet ist und zu einer Ausbreitung der „imperialen Lebensweise“ in breitere Schichten der Bevölkerung hinein geführt habe. Dies habe zunächst kritischen sozialen Richtungen wie der Ökologiebewegung und Drittweltinitiativen Auftrieb gegeben. Im Zuge der neoliberalen Offensive gab es stattdessen eine gewisse Verallgemeinerung der „imperialen Lebensweise“ im globalen Maßstab, vor allem in einigen Schwellenländern wie etwa in Lateinamerika oder China. Damit – wegen der sich verschärfenden Konkurrenz um Rohstoffe und Externalisierungsmöglichkeiten – wuchsen zugleich die Spannungen.
Die Autoren erläutern die Dimensionen der „imperialen Lebensweise“ am Beispiel des Autos. Insbesondere das SUV gilt ihnen als hervorstechender Ausdruck neoliberaler Subjektivität, in der die imperiale Lebensweise eingeschrieben ist. Soziale Polarisierung und marktförmiger Konkurrenz in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein drücken sich hier in besonderer Weise aus. Zugleich betonen sie, dass die als Ausweg aus den zerstörerischen Folgen des Automobilverkehrs gehandelte Einführung von Elektroautos eine nur scheinbare Lösung darstellt, wenn man nicht nur den Energieverbrauch beim Fahren, sondern die Rohstoffe und Energien berücksichtigt, die zu ihrer Produktion gebraucht werden.
Bei dieser „Ökologisierung“ des Automobilverkehrs handle es sich um den Versuch, durch „selektive Modernisierung“ die imperiale Lebensweise auf Dauer zu stellen. Von einer Eindämmung des Autoverkehrs zugunsten des öffentlichen Nahverkehrs, von einer Verkürzung und Vermeidung von Verkehrswegen und entsprechenden stadt- und raumplanerischen Maßnahmen sei dabei kaum die Rede.
Ein Anfang wäre es, seine Lebensweise zu hinterfragen
Insgesamt erteilen die Autoren den Vorstellungen von einem „grünen“ Kapitalismus eine deutliche Absage, und zwar deshalb, weil dabei die kapitalistischen Dynamiken und Herrschaftsverhältnisse ausgeblendet bleiben, die Grundlage der sich vervielfachenden Krisenerscheinungen seien. Die imperiale Lebensweise werde in ihren Grundzügen überhaupt nicht in Frage gestellt. Dies gelte auch dann, wenn die Kompensation ökologischer Zerstörungen selbst zu einem Vehikel der Kapitalverwertung gemacht wird. Es handle sich dabei vielmehr um eine neue Phase der kapitalistischen Naturaneignung. Dies wird am Beispiel des „land grabbing“ erläutert, der Übernahme von Ackerflächen durch große Investoren, die z.B. zum Anbau energieliefernder Pflanzen dienen und was zur Vertreibung der dort ansässigen Bevölkerung führt.
Das „Grünen“ des Kapitalismus“ verweise darauf, dass dieser durchaus über Möglichkeiten verfüge, seine Krisen zu bearbeiten. Er habe keine notwendige Naturgrenze. Vielmehr seien es „die über eine imperiale Naturaneignung vermittelte soziale Ungleichheit, an der sich zentrale sozial-ökologische Konflikte entzünden und demokratische Alternativen entwickelt werden können“.
Was dies heißen könnte, deuten Brand und Wissen im letzten Kapitel an. Sie gehen davon aus, dass die herrschende „multiple Krise“ (sozial, ökonomisch, ökologisch und politisch) einen Wendepunkt darstellen und gesellschaftsverändernde Initiativen vorantreiben könnte. Das wachsende Unbehagen an den bestehenden Verhältnissen deute darauf hin. Es komme vor allem darauf an, die eigene Lebensweise zu hinterfragen und praktische Ansätze einer solidarischen Gesellschaftsordnung zu entwickeln. Solche seien bereits in vielen Teilen der Welt anzutreffen. Ein Ziel müsse ein grundlegender institutioneller Umbau des Staates und eine umfassende Demokratisierung sein.
Die von den Autoren vorgelegte Analyse ist überzeugend. Recht vage bleiben allerdings die Überlegungen in Bezug auf mögliche gesellschaftliche Veränderungen. Dass sich aus einer Krise heraus emanzipative Bewegungen bilden, muss nach allen Erfahrungen mit einem Fragezeichen versehen werden. Möglich ist auch eine noch aggressivere Verteidigung der herrschenden Lebensweise, verbunden mit einer Verhärtung autoritärer Herrschaftsformen. Dass dabei die Waffenproduktion als Quelle des Kapitalprofits eine zunehmende Rolle spielen könnte, zeichnet sich bereits deutlich ab. Wenig ausgeführt sind auch die Überlegungen, wie ein institutioneller Umbau des Staates konkret aussehen sollte und vor allem wie eine „solidarische Lebensweise“, d.h. eine andere Ökonomie praktisch zu regulieren wäre. Wenn es um die Veränderung von Bewusstsein und die Entwicklung einer alternativen Hegemonie gehen soll, müsste das deutlicher ausbuchstabiert werden.
Es ist den Autoren nicht vorzuwerfen, dass sie keinen Masterplan für eine ökonomisch und politisch andere Gesellschaft vorstellen. Dazu braucht es praktische Erfahrungen und ihre Reflexion ebenso wie weiter gehende theoretische Diskussionen. Dazu genügend Anlass gegeben zu haben, ist das Verdienst dieses äußerst lesenswerten Buches.
„Unsere imperiale Lebensweise muss verändert werden“
Ulrich Brand, Professor an der Universität Wien, ist seit vielen Jahren in der globalisierungskritischen Bewegung aktiv. Im Rahmen einer interdisziplinären Gruppe untersucht er in Lateinamerika „Alternativen zur Entwicklung“. Auch zum extraktivistischen Entwicklungsmodell. Mit ihm sprach Südwind-Redakteur Werner Hörtner.
Südwind-Magazin: Die Ausbeutung von Rohstoffen gilt immer noch als unentbehrliche Grundlage für die industrielle Entwicklung und den Wohlstand des globalen Nordens. Und obwohl nur ein geringer Teil der Wertschöpfung im Ursprungsland selbst bleibt, betrachten die exportierenden Staaten des Südens den Extraktivismus als Rettung für ihre Budgets. Wie kann man diesen Ländern eine post-extraktivistische Lösung schmackhaft machen?
Ulrich Brand: Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, man muss aber auch sehen, wo die Hindernisse liegen. In den Extraktionsländern ist es schwer, den herrschenden Eliten eine post-extraktivistische Lösung schmackhaft zu machen, weil sie gut daran verdienen. Wenn wir über Post-Extraktivismus reden – und das ist auch der Ansatz unserer Arbeitsgruppe –, so reden wir in erster Linie über kritische politische Kräfte, über soziale Bewegungen. Also wären erst einmal die Vorschläge und Erfahrungen von alternativen Akteuren ernst zu nehmen. Etwa die der Landlosenbewegung in Brasilien hinsichtlich einer ökologischen kleinbäuerlichen Landwirtschaft oder die der indigenen Bewegungen in den Andenländern. Die Erfahrung der Bewegungen ist: Industrielle Landwirtschaft ist nicht für die lokale Bevölkerung, die Förderung von Öl macht alles kaputt, Goldabbau zerstört alles. Deren Vorschläge zu kennen, ist ein wichtiger Teil der Arbeit unserer Gruppe. Wir sehen rasch: Es gibt genügend Alternativen, von lokaler Ökonomie wie etwa ökologischem Tourismus oder ökologischem Landbau. Das wäre einmal die lokale Ebene.
Welche anderen Auswege oder Alternativen gibt es?
Auf der nationalen Ebene steht in Lateinamerika die alte Frage nach einer Landreform auf dem Tapet. Wir können nur wegkommen vom extraktivistischen Modell, wenn es eine andere ökonomische Struktur gibt. Auf dieser Ebene geht es darum, alternative Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle voranzutreiben, also wegzukommen von dieser großen Abhängigkeit der Staatsbudgets, der damit einhergehenden Verteilungsspielräume vom Verkauf der agrarischen, mineralischen und fossilen Rohstoffe auf dem Weltmarkt. Das beinhaltet die Frage nach nachhaltigen Formen der Industrialisierung in den Ländern und ganz zentral die der Landreform, die Frage der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen.
Die dritte Ebene, wo wir noch nicht viele Antworten haben, ist sicherlich die internationale Ebene. Wie wird den Ländern, und zwar sowohl den Regierungen und Eliten als auch den Bevölkerungen, garantiert, dass durch ein deutliches Herunterfahren dieses gierigen, zerstörerischen Extraktivismus für sie keine großen Verluste entstehen? Da sind wir bei der Frage einer solidarischen internationalen Wirtschaftspolitik, bei der Frage der Preisregulierung, der Einschränkung der Macht der transnationalen Unternehmen. Wie wird z.B. in Ecuador Wohlstand geschaffen und werden dafür vielleicht Mittelzuflüsse von außen gesichert, wenn in zehn Jahren das Land nur mehr ein Viertel des Erdöls – verglichen mit heute – exportiert?
Sind wir in den reichen Ländern nicht auch in diese Problematik eingebunden?
Das würde ich als eine vierte Dimension bezeichnen, nämlich dass die Produktions- und Lebensweisen – unsere imperiale Lebensweise, wie ich es gemeinsam mit Markus Wissen nenne – unbedingt verändert werden muss. Sie ist es ja, die diesen Extraktivismus erzwingt. Also die Frage nach dem Post-Extraktivismus muss auch hier bei uns, auch in Österreich gestellt werden und nicht nur in Ecuador und außereuropäischen Regionen.
Gibt es Regierungen oder Politiker im Süden, die ernsthaft einen Ausweg aus dieser Rohstofffalle suchen?
Die Politiker, die am ehesten dazu gedrängt werden und die eigentlich auf Grund ihrer Verfassung dazu verpflichtet wären, sind natürlich Correa, Morales und Chávez. Sie verpflichten sich auch in ihren Diskursen immer wieder dazu. Wir von der Arbeitsgruppe haben nun eine Studie zu diesem Thema erstellt, mit dem Ergebnis, dass dieser Versuch in allen drei Ländern misslingt. Die politischen und ökonomischen Kräfte, die eine Fortführung des Extraktivismus aufgrund der erhöhten Rohstoff-Renten wollen, sind einfach zu stark. Und die Frage einer Agrarreform wird überhaupt nicht aufgenommen. In Brasilien und Argentinien gibt es sogar einen begeisterten Pro-Extraktivismus, auch wenn die brasilianische Regierung dauernd von „grüner Ökonomie“ spricht – was in Argentinien übrigens kaum jemand macht.
Ein interessantes Phänomen gibt es in Thailand. Dort hat der König nach der Krise 1997 das Konzept einer „Suffizienz-Ökonomie“ ausgerufen, die im öffentlichen Diskurs ziemlich stark ist und die teilweise auf der lokalen Ebene auch umgesetzt wird, die aber in einem ähnlichen Dilemma steckt. Dennoch sind Thailand und noch stärker Bhutan wichtige Beiträge zum Post-Extraktivismus. Es ist ganz wichtig, in Bhutan, wo ein buddhistisches Gesellschaftsverständnis stark im Alltag verankert ist, sich anzuschauen, was bedeutet da Leben, was bedeutet Gesellschaft, soziales Verhalten. Das kann nicht eins zu eins übertragen werden. Der Horizont des Guten Lebens aus den Andenländern ja auch nicht. Und dennoch bieten diese Erfahrungen viele Anknüpfungspunkte.
Hat Ihre Arbeitsgruppe schon praktikable Modelle von „Alternativen zur Entwicklung“ gefunden?
Wir sind bald nach der Konstitutierung unserer Gruppe aufs Land im nördlichen Ecuador gefahren und haben uns Widerstände gegen Bergbauprojekte angesehen. Als eine Untersuchungsperspektive geht es uns darum, über die aktuellen Konflikte im Extraktivismus herauszubekommen, wie Alternativen entstehen, was ihr Stellenwert ist. Bis jetzt sind wir stark mit mineralischen Rohstoffen und fossilen Energieträgern befasst, weniger mit agrarischen Rohstoffen.
Wir verfolgen mit unserer Arbeit eine kritische Wissensproduktion, die in der Bewegung, aber auch in staatlichen Apparaten in den Medien eine Rolle spielt. Wir machen keine Strategiepapiere, keine Aufrufe, sondern wir wollen über Erfahrungsaustausch und Reflexion in der Analyse weiterkommen. Die soll dann unterschiedlichen Akteuren bei ihren Positionsbestimmungen und Strategieentwicklungen durchaus helfen.
Ulrich Brand studierte Tourismus mit dem Schwerpunkt Hotellerie an der Berufsakademie Ravensburg und anschließend Politikwissenschaft in Frankfurt/M., Berlin und Buenos Aires. Ab 2007 Professor für Internationale Politik an der Universität Wien, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von Attac Deutschland und in der Bundeskoordination Internationalismus (BUKO). Seine Arbeitschwerpunkte sind kritische Staats- und Gesellschaftstheorie, Ressourcen- und Umweltpolitik, Lateinamerika.
____________________________________________________

Ulrich Brand/Markus Wissen: Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus, 224 S., 14,95 €;
I.L.A. Kollektiv: Auf Kosten anderer? Wie die imperiale Lebensweise ein gutes Leben für alle verhindert,128 S., 19,95 €, beide oekom-Verlag 2017.