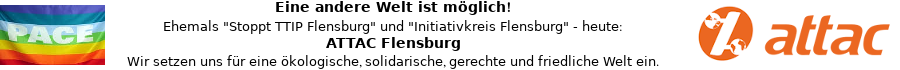Die Bundesregierung versucht weiter, die Herausforderungen der Länder des globalen Südens von außen zu lösen und setzt dazu unbeirrt auf die neoliberale »Medizin« freier Märkte und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Das muss sich ändern.
»Fluchtursachen überwinden« ist zu einem Credo der deutschen Politik geworden. Auch im sogenannten »Masterplan Migration« von Bundesinnenminister Horst Seehofer taucht der Begriff auf. Um die Perspektivlosigkeit in weiten Teilen Afrikas zu überwinden, müssen jährlich mindestens 20 Millionen Arbeitsplätze neu geschaffen werden, schreibt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Hat es die richtigen Rezepte dafür?
Die Entwicklungspolitik ist ein herausforderndes Politikfeld. Sie darf nicht einseitig als Sozialpolitik für die Länder des globalen Südens betrachtet werden. Vielmehr müssen Politikfelder wie beispielsweise die Handelspolitik und die globale Finanz- und Steuerarchitektur stets mitgedacht werden. Zentraler Bestandteil der deutschen Entwicklungspolitik sollte es sein, die Ursachen von ausbleibender sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung überwinden zu helfen. Sie sollte den Partnern im globalen Süden die politischen Handlungsspielräume dazu geben anstatt von außen an Symptomen herumzudoktern.
Der Afrikaplan von Entwicklungsminister Gerd Müller – der Marshallplan mit Afrika – erkennt diese Herausforderung nach größerer entwicklungspolitischer Kohärenz stellenweise an. Doch der vermeintlich große Wurf scheint erneut zu einem Papiertiger zu werden. Von einem Paradigmenwechsel ist die deutsche Entwicklungspolitik noch immer weit entfernt.
Zentrale Herausforderungen afrikanischer Staaten
So unterschiedlich die Länder des globalen Südens sind, sie teilen einige zentrale Herausforderungen. In den meisten Ländern besteht eine hohe Unterbeschäftigung und Jugendarbeitslosigkeit. 84 Prozent der arbeitenden Bevölkerung in Afrika sind im informellen Sektor aktiv, das heißt beispielsweise als Straßenhändler, Tagelöhner und Kleinbauern. Es mangelt an formalen Arbeitsverhältnissen, die ein sicheres Einkommen ermöglichen würden. Die Wirtschaftsstruktur der afrikanischen Staaten ist überwiegend durch landwirtschaftliche Kleinbetriebe und den Rohstoffsektor bestimmt. Der industrielle Sektor ist unterentwickelt.
Dementsprechend gibt es auch kaum Wirtschaftsakteure, die besteuert werden könnten. Ein Problem, dass durch die Steuerflucht im Rohstoffsektor noch verstärkt wird (hier). Derzeit finanzieren sich viele afrikanische Staaten noch immer durch externe Quellen. Sei es durch bi- und multilaterale Entwicklungshilfe oder durch eine Auslandsverschuldung am Kapitalmarkt. Die aufgenommenen Schulden werden häufig nicht in die Diversifizierung der Wirtschaft investiert (Gründe siehe unten). Bei Weltmarktschocks wie dem Verfall von Rohstoffpreisen, drohen die Schulden nicht tragfähig zu werden. Es kommt wiederholt zu Schuldenkrisen.
Die deutsche Entwicklungspolitik tut zu wenig, um ein internationales Umfeld zu schaffen, innerhalb dem die Länder des globalen Südens diese Herausforderungen überwinden können.
Freihandelsdogma dominiert
In der Handelspolitik besteht Deutschland auf dem Abschluss von Freihandelsabkommen mit den afrikanischen Staaten (Wirtschaftspartnerschaftsabkommen – EPAs). Afrikanische Staaten sollen ihre Märkte öffnen, erlangen aber kaum Vorteile, da sie theoretisch meist schon freien Zugang zum EU Markt haben (hier). Durch die Marktöffnung drohen afrikanische Unternehmen und Kleinbauern durch Importe noch weiter marginalisiert zu werden. Denn afrikanische Staaten sind Studien zufolge nur bei 15 – 35 Prozent aller Produkte wettbewerbsfähig genug, um auf dem Weltmarkt bestehen zu können.
Das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE) fordert in einem von Entwicklungsminister Müller angefragten Papier, dass es den afrikanischen Staaten möglich sein müsse, »Teile der eigenen Wirtschaft vorübergehend vor dem übermächtigen internationalem Wettbewerb zu schützen« (hier). Damit würden die afrikanischen Staaten keinen Sonderweg einschlagen, sondern sich ein Beispiel an den erfolgreichen Industrialisierungsprozessen in den USA, Deutschland, Japan, Südkorea oder jüngst China nehmen. Alle diese Staaten konnten erst einheimische Industrien aufbauen, bevor sie ihre Wirtschaft für den Weltmarkt geöffnet haben.
Die EPAs zementieren hingegen das Freihandelssystem, welches mit der Schaffung der Welthandelsorganisation (WTO) institutionalisiert wurde. Und sie gehen über WTO-Bestimmungen hinaus. So schränken die EPAs beispielsweise industriepolitische Maßnahmen wie Exportsteuern und Bedingungen für ausländische Investitionen zur Förderung der einheimischen Wertschöpfung (local content clauses) weiter ein (hier).
Dabei gibt es Alternativen. Statt der Freihandelspolitik sollte Europa die regionale Integration Afrikas, also den Aufbau regionaler Märkte, unterstützen. Daneben könnten Beratungsleistungen – wie das vom DIE vorgeschlagene »Zukunftsprogramm afrikanischer Strukturwandel« – angeboten werden, damit afrikanische Industrien von handelspolitischen Schutzmaßnahmen profitieren anstatt dass diese auf politisch gut vernetzte »Unternehmer« zugeschnitten werden (hier mehr Details). Spannend ist, dass selbst Vertreter deutscher Wirtschaftsverbände auf ihren privaten Twitteraccounts schreiben, dass es eine starke afrikanische Wirtschaft brauche, da ohne lokale Partner und Kunden kaum von außen investiert werde.
Entwicklungsfinanzierung
Auch bei der Entwicklungsfinanzierung greift die Diskussion in Deutschland häufig viel zu kurz. Meist wird das Ziel in den Vordergrund gerückt, 0,7 Prozent des deutschen Bruttonationaleinkommens für die Entwicklungszusammenarbeit aufzuwenden. Während dieses Ziel löblich ist, verringert es nicht die Abhängigkeit Afrikas von externen Mittelgebern. Weitaus nachhaltiger wäre es, den illegalen Abfluss von Finanzmitteln und die Ausbeutung afrikanischer Reichtümer zu beenden. So verlieren die afrikanischen Staaten jährlich eine geschätzte Summe zwischen 30 und 100 Milliarden Euro an potenziellen Staatseinnahmen infolge von Steuerflucht zumeist multinationaler Konzerne. Hinzu kommen Abflüsse durch die Ausbeutung afrikanischer Fischbestände oder für den Schuldendienst infolge verantwortungsloser Kredite, die mitunter von korrupten Staatschefs aufgenommen wurden (hier).
Zusätzlich zu alljährlichen Versprechungen (Regierung) und Forderungen (Opposition) der Erhöhung der ODA-Quote (= Anteil der öffentlichen Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit am Bruttonationaleinkommen, BNE) sollte sich die Politik ehrlich machen und helfen, den Abfluss illegaler Finanzströme einzudämmen. Auf internationaler Ebene dürfte Deutschland nicht mehr bei der Bekämpfung der Steuerflucht bremsen (hier). Vielmehr sollte sich die deutsche Politik für eine Einbeziehung der Länder des Südens im Kampf gegen die Steuerflucht – also einer Verlagerung dieses Themas von der OECD hin zu UN – einsetzen. Auf nationaler Ebene könnte Deutschland endlich anfangen, auch afrikanische Länder am Informationsaustausch über Steuerdaten teilhaben zu lassen, statt die Steuerbehörden Afrikas weiter im Dunkeln tappen zu lassen und es Steuerflüchtlingen noch leichter zu machen (hier).
Marktgläubigkeit statt Anerkennung des Entwicklungsstaates
Obwohl der »Marshallplan mit Afrika«, der zentrale Entwicklungsplan von Entwicklungsminister Müller, einige progressive Passagen enthält, ist die deutsche Entwicklungspolitik noch immer zu marktbasiert ausgerichtet. Der vom damaligen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ins Leben gerufene »G20 Compact with Africa« fußt darauf, die Rahmenbedingungen für private Investitionen in Afrika zu verbessern. Afrikanische Staaten mussten sich beim G20-Treffen in Hamburg wie in einer Casting-Show mit ihren geplanten Reformbemühungen zur Verbesserung des Investitionsklimas bei Investoren und Partnerländern aus dem globalen Norden bewerben.
Ähnlich wie in der Wirtschaftspolitik für Europa, steht beim Compact die Wettbewerbsfähigkeit afrikanischer Staaten im Vordergrund. Durch beispielsweise schlanke Regulierungen, ein investitionsfreundliches Steuersystem, makroökonomische Stabilität, Investitionsschutz und Garantien zur Verringerung von Investitionsrisiken sollen ausländische Investoren nach Afrika gelockt werden (hier Details).
Der Fokus auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Investitionsbedingungen beißt sich selbst in den Schwanz. Denn ein Land, welches seine Investitionsbedingungen verbessert, lockt nur so lange Unternehmen an, bis ein anderes Land noch bessere Investitionsbedingungen aufweisen kann. Es besteht also die Gefahr, dass die afrikanischen Staaten miteinander um die kargen Investitionen ausländischer Unternehmen konkurrieren, dass sich also mittelfristig Kosten und Ertrag nicht mehr die Waage halten. Es zeigt sich, wie wichtig es ist, die einheimische Wirtschaft zu fördern. Lokale Unternehmen haben ein genuines Interesse an der Entwicklung ihres Landes und sind dort viel stärker verwurzelt. Im Gegensatz zu internationalen Firmen werden sie ihr Land nicht verlassen, wenn es in einem Nachbarland vermeintlich bessere Investitionsbedingungen gibt.
Die deutsche Entwicklungspolitik muss sich endlich vom neoliberalen Dogma freier Märkte und des schlanken Staates lösen. Die Entwicklungserfolge der asiatischen Tigerstaaten und später Chinas zeigen die Bedeutung eines starken Staates, denn sie beruhten nicht auf freien Marktkräften. Der Schutz für einheimische Produzenten, die Bereitstellung von Krediten für produktive Unternehmen und strategisch wichtige Industriesektoren, die Förderung der Ausbildung und später von Innovationen und technologischem Fortschritt waren essentielle staatliche Leistungen, ohne die den asiatischen Staaten kein so erfolgreicher Aufholprozess gelungen wäre (hier).
Fazit
Abschließend ist festzuhalten, dass die deutsche Entwicklungspolitik nicht im leeren Raum stattfindet. Sie wird von deutschen Wirtschaftsinteressen und wirtschaftspolitischen Überzeugungen beeinflusst. So ist Deutschland mit seinem exportlastigen Wirtschaftsmodell vom freien Zugang zu Exportmärkten abhängig. In Regierungskreisen wird wahrscheinlich befürchtet, dass protektionistische Maßnahmen wieder an Attraktivität gewinnen könnten, wenn sie Entwicklungsländern erlaubt wären. Befürchtet wird scheinbar, dass sich auch größere Handelspartner dieser Maßnahmen bedienen und Deutschland Exportmärkte verlieren würde.
Zudem setzt Deutschland sowohl im Inland als auch bei europäischen »Krisenländern« komplett auf die Verbesserung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit, also auf ein neoliberales Wirtschaftsmodell, in dem Staaten wie Unternehmen angesehen werden und es hauptsächlich um die Senkung von Kosten geht. Diese wirtschaftspolitischen Überzeugungen werden sich letztendlich immer auf die Entwicklungspolitik übertragen. Dementsprechend ist nicht absehbar, dass Deutschland sich in der Entwicklungspolitik für eine stärkere Rolle des Staates oder eine Abkehr vom Dogma der Wettbewerbsfähigkeit einsetzen wird.
Das deutsche Wirtschaftsmodell steht somit einem Paradigmenwechsel in der Entwicklungspolitik im Weg. Deutschland wird weiter versuchen, die Herausforderungen der Länder des globalen Südens von außen zu lösen und dazu weiter die neoliberale »Medizin« freier Märkte und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit verschreiben. Der Aufbau oder vielmehr die Rekonstruktion eines Weltwirtschaftssystems, in dem wirtschaftlich schwächere Länder politisch ausreichend Handlungsspielräume haben, um eigene Entwicklungspfade zu bestreiten – wie es Südkorea, Taiwan und Co. in den 1960er und 1970er Jahren taten (hier) – wird somit auch von Deutschland verbaut.
Nico Beckert beschäftigt seit über zehn Jahren mit entwicklungspolitischen Themen. Sein Beitrag erschien auch auf seinem Blog und zuerst auf dem Portal WI(e)SO – Wie sozial kann Wirtschaft sein.