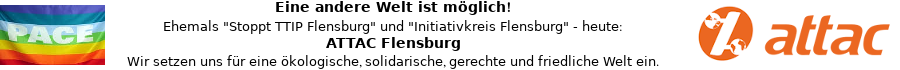Handelskrieg Eröffnet der Rückbau der globalen Güterketten Handlungsspielraum für ökosozialen Umbau?
Andrea Komlosy | aus FREITAG Ausgabe 13/2018
In der Geschichte des globalen Kapitalismus setzte Protektionismus dann ein, als sich westeuropäische Staaten, allen voran Großbritannien, im 18. Jahrhundert vom Freihandel abwandten und begannen, die einheimische Industrieproduktion gegenüber der damals den Weltmarkt beherrschenden asiatischen Konkurrenz zu schützen. Mit Zöllen, Import- und Konsumverboten ging die Sicherung der Absatzmärkte einher. Waffengewalt tat ein Übriges. Einmal an der Spitze, erfolgte der Wechsel zum Freihandel, um damit Bezugs- und Absatzmärkte zu sichern. Schutzmaßnahmen wurden nun von jenen ergriffen, die den Aufbau industrieller Kapazitäten auf ihrem Staatsgebiet fördern wollten: im 19. Jahrhundert vor allem Deutschland und die USA, im 20. Jahrhundert jene postkolonialen Staaten, die in Osteuropa und im globalen Süden aus den (Kolonial-)Reichen hervorgegangen waren. Aus der Perspektive der Marktführer, die Öffnung einforderten, wurde Protektionismus nun als Störung des freien Handels diffamiert.
Aus der Perspektive der Entwicklung, die mit der Entkolonisierung zum beherrschenden Topos der postkolonialen Staaten wurde, war der Schutz vor der übermächtigen Marktmacht der westlichen Großmächte eine zentrale Voraussetzung für die Überwindung ihrer Abhängigkeit. Die Strategien traten unter unterschiedlichen Leitideen auf: Abkoppelung, Dissoziation, Delinking, Dependencia, Autozentrierung. Sie ordneten sich unterschiedlichen Weltanschauungen von sozialistisch, national bis kapitalistisch zu, waren in der Praxis jedoch meist durch Pragmatismus geprägt, um die auf der Konferenz von Bandung im Jahr 1955 gefassten Vorstellungen eines selbstbestimmten Dritten Weges durch Ausnützen der Widersprüche des Kalten Kriegs am besten in die Tat umzusetzen.
Um ausländische Investitionen, Kredit, Technologie und Know-how zu erhalten, waren die Entwicklungsländer gezwungen, ihre Märkte für westliche Waren zu öffnen – insbesondere, seit von den 1970er Jahren an die Umwandlung der zentralisierten Fabrik am Konzernsitz in eine Kette von Produktionsstandorten einsetzte, an die einzelne Arbeitsschritte ausgelagert wurden. Diese sogenannten globalen Güterketten erforderten die bedingungslose Freiheit des Waren- und Kapitalverkehrs, um Komponenten just in time an die jeweils kostengünstigsten Standorte zu transferieren.
Einigen größeren Schwellenländern gelang es dabei, die untergeordnete Rolle als „verlängerte Werkbank“ am untersten Ende zum Aufstieg in wertschöpfungsintensivere Positionen in der Güterkette zu nutzen. Am erfolgreichsten dabei waren China und Indien. Beide konnten auf einer alten industriellen Tradition aufbauen, bis sie mit Kolonisierung (Indien) und „ungleichen Verträgen“ im Gefolge der Opiumkriege (China) im 19. Jahrhundert in die Knie gezwungen wurden. Nun stellten sie wieder ernsthafte Konkurrenten für die alten Industrieländer dar.
Chinas Handelsüberschuss beunruhigt die westlichen Märkte; noch beunruhigender sind die US-Staatsanleihen von über 1,2 Billionen Dollar in chinesischen Händen. Was unter Deng Xiaoping als Kontraktfertigung mit billigen und rechtlosen Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeitern begann, hat sich in der Zwischenzeit zu einem aufstrebenden Industrieland emanzipiert, das die Arbeiter und Arbeiterinnen seit der Wirtschaftskrise 2008 durch Lohnerhöhung und soziale Absicherung zunehmend mit Kaufkraft ausstattet. Im Westen wird oft herablassend bis feindlich über die unlauteren Wettbewerbspraktiken Pekings gesprochen, ohne zu bedenken, dass die Kombination von Öffnung und Protektion, Staat und Privatunternehmen, Innovation und Technologiespionage, Bündnispolitik und militärischem Säbelrasseln gerade jene Ingredienzien umfasst, die den westlichen Industrieländern zu ihrem Höhenflug verholfen haben.
Schwellenländer im Aufwind
Während die USA und Europa den Zenit ihrer Wirtschaftsmacht überschritten haben, befinden sich heute China, Indien, Vietnam und andere Schwellenländer im Aufstieg. Sie nutzen die Spielregeln des freien Wettbewerbs, welche die Welthandelsorganisation als unumstößlich aufgestellt hat, im eigenen Interesse und verbinden ihre neue Rolle in der Welt mit einheimischen kulturellen Werten und Traditionen.
Die alten Industriestaaten sehen sich von dieser Entwicklung aus ihrer Hegemonie gedrängt. Die Bastionen aus Vermögen, Know-how und Macht über Institutionen, die sie immer noch innehaben, können ihre Privilegien nicht mehr schützen. Es setzen Verteilungskämpfe nach innen – die Reichen werden immer reicher – und nach außen hin ein. Der viel geschmähte Protektionismus kehrt auf die Tagesordnung zurück: Die Rede ist von Reindustrialisierung und von Strafzöllen; auch die Formierung von Wirtschaftsblöcken zur Verbesserung der einzelstaatlichen Konkurrenzfähigkeit ist Ausdruck dieses Machtverlusts. Die Europäische Union schiebt den Schwarzen Peter gerne den USA und ihrem Präsidenten Donald Trump zu, agiert aber im Grunde mit den gleichen Mitteln: Auge um Auge, Zahn um Zahn, jedoch vereint in der Abwehr der aufsteigenden Schwellenländer.
Was wollen die Protektionismen im Abstieg bewirken? Industrie und Arbeitsplätze sollen an die alten Standorte zurückgebracht werden. Zölle verteuern dieImporte und sollen à la longue zur Importsubstitution führen. Importverbote schützen die einheimische Produktion vor billigerer ausländischer Konkurrenz. US-Zölle und Importbarrieren werden Unternehmen motivieren, Produktionsstätten in die USA zu verlagern. Ein Rückbau der Güter- und Standortketten zugunsten einer Lokalisierung der Produktion ist denkbar. Es wäre der Beginn einer weltwirtschaftlichen Trendwende in Richtung Regionalisierung.
Sollen Kritiker der globalen Ungleichheit angesichts der vollmundigen „Great“- und „First“-Ansagen alter Industrieländer in den Chor der liberalen Freihandelsapologetik einstimmen und von den Protektionisten Marktoffenheit einfordern?
Ich plädiere dafür, diese Ansagen trotz des präpotenten Muskelspiels, welches sie begleitet, als Chance zu begreifen. Erstens öffnen sie Denkraum dafür, die Mär der wohlstandsfördernden Effekte eines ungehinderten Kapital- und Warenverkehrs zu hinterfragen. Die neomerkantilistische Selbststärkungsstrategie der alten Zentren öffnet einen Spielraum. Aus ökologischer, sozialer und entwicklungspolitischer Perspektive könnte daran angeknüpft werden, um der krisenhaften Zuspitzung der Verhältnisse zu entkommen.
Ich bin mir bewusst, dass die Protektionismen der alten Industriemächte eine solche Alternative nicht im Auge haben. Ob ihre Kehrtwende in Sachen Deglobalisierung tatsächlich den Handlungsspielraum für sozialökologische Alternativen öffnet oder auf Krieg zusteuert, hängt nicht von den Zöllen ab, sondern davon, ob die Waffen, die sich trotz des Verlusts ökonomischer Führung in ihren Arsenalen konzentrieren, zum Einsatz gebracht werden.
Andrea Komlosy lehrt Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien. Sie hat gerade das Buch "Grenzen. Räumliche und soziale Trennlinien im Zeitenlauf" (Promedia 2018, 248 S., 19,90 €) veröffentlicht
Andrea Komlosy | aus FREITAG Ausgabe 13/2018
In der Geschichte des globalen Kapitalismus setzte Protektionismus dann ein, als sich westeuropäische Staaten, allen voran Großbritannien, im 18. Jahrhundert vom Freihandel abwandten und begannen, die einheimische Industrieproduktion gegenüber der damals den Weltmarkt beherrschenden asiatischen Konkurrenz zu schützen. Mit Zöllen, Import- und Konsumverboten ging die Sicherung der Absatzmärkte einher. Waffengewalt tat ein Übriges. Einmal an der Spitze, erfolgte der Wechsel zum Freihandel, um damit Bezugs- und Absatzmärkte zu sichern. Schutzmaßnahmen wurden nun von jenen ergriffen, die den Aufbau industrieller Kapazitäten auf ihrem Staatsgebiet fördern wollten: im 19. Jahrhundert vor allem Deutschland und die USA, im 20. Jahrhundert jene postkolonialen Staaten, die in Osteuropa und im globalen Süden aus den (Kolonial-)Reichen hervorgegangen waren. Aus der Perspektive der Marktführer, die Öffnung einforderten, wurde Protektionismus nun als Störung des freien Handels diffamiert.
Aus der Perspektive der Entwicklung, die mit der Entkolonisierung zum beherrschenden Topos der postkolonialen Staaten wurde, war der Schutz vor der übermächtigen Marktmacht der westlichen Großmächte eine zentrale Voraussetzung für die Überwindung ihrer Abhängigkeit. Die Strategien traten unter unterschiedlichen Leitideen auf: Abkoppelung, Dissoziation, Delinking, Dependencia, Autozentrierung. Sie ordneten sich unterschiedlichen Weltanschauungen von sozialistisch, national bis kapitalistisch zu, waren in der Praxis jedoch meist durch Pragmatismus geprägt, um die auf der Konferenz von Bandung im Jahr 1955 gefassten Vorstellungen eines selbstbestimmten Dritten Weges durch Ausnützen der Widersprüche des Kalten Kriegs am besten in die Tat umzusetzen.
Um ausländische Investitionen, Kredit, Technologie und Know-how zu erhalten, waren die Entwicklungsländer gezwungen, ihre Märkte für westliche Waren zu öffnen – insbesondere, seit von den 1970er Jahren an die Umwandlung der zentralisierten Fabrik am Konzernsitz in eine Kette von Produktionsstandorten einsetzte, an die einzelne Arbeitsschritte ausgelagert wurden. Diese sogenannten globalen Güterketten erforderten die bedingungslose Freiheit des Waren- und Kapitalverkehrs, um Komponenten just in time an die jeweils kostengünstigsten Standorte zu transferieren.
Einigen größeren Schwellenländern gelang es dabei, die untergeordnete Rolle als „verlängerte Werkbank“ am untersten Ende zum Aufstieg in wertschöpfungsintensivere Positionen in der Güterkette zu nutzen. Am erfolgreichsten dabei waren China und Indien. Beide konnten auf einer alten industriellen Tradition aufbauen, bis sie mit Kolonisierung (Indien) und „ungleichen Verträgen“ im Gefolge der Opiumkriege (China) im 19. Jahrhundert in die Knie gezwungen wurden. Nun stellten sie wieder ernsthafte Konkurrenten für die alten Industrieländer dar.
Chinas Handelsüberschuss beunruhigt die westlichen Märkte; noch beunruhigender sind die US-Staatsanleihen von über 1,2 Billionen Dollar in chinesischen Händen. Was unter Deng Xiaoping als Kontraktfertigung mit billigen und rechtlosen Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeitern begann, hat sich in der Zwischenzeit zu einem aufstrebenden Industrieland emanzipiert, das die Arbeiter und Arbeiterinnen seit der Wirtschaftskrise 2008 durch Lohnerhöhung und soziale Absicherung zunehmend mit Kaufkraft ausstattet. Im Westen wird oft herablassend bis feindlich über die unlauteren Wettbewerbspraktiken Pekings gesprochen, ohne zu bedenken, dass die Kombination von Öffnung und Protektion, Staat und Privatunternehmen, Innovation und Technologiespionage, Bündnispolitik und militärischem Säbelrasseln gerade jene Ingredienzien umfasst, die den westlichen Industrieländern zu ihrem Höhenflug verholfen haben.
Schwellenländer im Aufwind
Während die USA und Europa den Zenit ihrer Wirtschaftsmacht überschritten haben, befinden sich heute China, Indien, Vietnam und andere Schwellenländer im Aufstieg. Sie nutzen die Spielregeln des freien Wettbewerbs, welche die Welthandelsorganisation als unumstößlich aufgestellt hat, im eigenen Interesse und verbinden ihre neue Rolle in der Welt mit einheimischen kulturellen Werten und Traditionen.
Die alten Industriestaaten sehen sich von dieser Entwicklung aus ihrer Hegemonie gedrängt. Die Bastionen aus Vermögen, Know-how und Macht über Institutionen, die sie immer noch innehaben, können ihre Privilegien nicht mehr schützen. Es setzen Verteilungskämpfe nach innen – die Reichen werden immer reicher – und nach außen hin ein. Der viel geschmähte Protektionismus kehrt auf die Tagesordnung zurück: Die Rede ist von Reindustrialisierung und von Strafzöllen; auch die Formierung von Wirtschaftsblöcken zur Verbesserung der einzelstaatlichen Konkurrenzfähigkeit ist Ausdruck dieses Machtverlusts. Die Europäische Union schiebt den Schwarzen Peter gerne den USA und ihrem Präsidenten Donald Trump zu, agiert aber im Grunde mit den gleichen Mitteln: Auge um Auge, Zahn um Zahn, jedoch vereint in der Abwehr der aufsteigenden Schwellenländer.
Was wollen die Protektionismen im Abstieg bewirken? Industrie und Arbeitsplätze sollen an die alten Standorte zurückgebracht werden. Zölle verteuern dieImporte und sollen à la longue zur Importsubstitution führen. Importverbote schützen die einheimische Produktion vor billigerer ausländischer Konkurrenz. US-Zölle und Importbarrieren werden Unternehmen motivieren, Produktionsstätten in die USA zu verlagern. Ein Rückbau der Güter- und Standortketten zugunsten einer Lokalisierung der Produktion ist denkbar. Es wäre der Beginn einer weltwirtschaftlichen Trendwende in Richtung Regionalisierung.
Sollen Kritiker der globalen Ungleichheit angesichts der vollmundigen „Great“- und „First“-Ansagen alter Industrieländer in den Chor der liberalen Freihandelsapologetik einstimmen und von den Protektionisten Marktoffenheit einfordern?
Ich plädiere dafür, diese Ansagen trotz des präpotenten Muskelspiels, welches sie begleitet, als Chance zu begreifen. Erstens öffnen sie Denkraum dafür, die Mär der wohlstandsfördernden Effekte eines ungehinderten Kapital- und Warenverkehrs zu hinterfragen. Die neomerkantilistische Selbststärkungsstrategie der alten Zentren öffnet einen Spielraum. Aus ökologischer, sozialer und entwicklungspolitischer Perspektive könnte daran angeknüpft werden, um der krisenhaften Zuspitzung der Verhältnisse zu entkommen.
Ich bin mir bewusst, dass die Protektionismen der alten Industriemächte eine solche Alternative nicht im Auge haben. Ob ihre Kehrtwende in Sachen Deglobalisierung tatsächlich den Handlungsspielraum für sozialökologische Alternativen öffnet oder auf Krieg zusteuert, hängt nicht von den Zöllen ab, sondern davon, ob die Waffen, die sich trotz des Verlusts ökonomischer Führung in ihren Arsenalen konzentrieren, zum Einsatz gebracht werden.
Andrea Komlosy lehrt Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien. Sie hat gerade das Buch "Grenzen. Räumliche und soziale Trennlinien im Zeitenlauf" (Promedia 2018, 248 S., 19,90 €) veröffentlicht