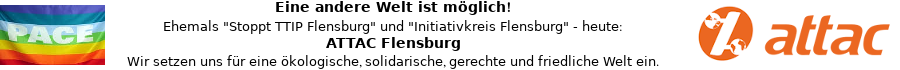Über Sinn und Unsinn der immer höheren und umfassenderen US-Zölle
Seit einigen Wochen bewegt viele die Frage, was wohl hinter der Zollpolitik Donald Trumps stecken mag, so auch unsere Redaktion. Anders als einige behaupten, jedenfalls keine gezielte Strategie, meint Redaktionsmitglied Werner Rätz, und spricht sich für die Verortung des Trumpschen Handelns in die bereits seit einigen Jahrzehnten währende Krise des kapitalistischen Wirtschaftssystems aus. Der Text entstand als Diskussionsbeitrag während unseres Gruppentreffens. Er liefert somit keine tiefgründige Analyse, sondern ist ein erster Aufschlag zur weiteren Diskussion.
von Werner Rätz
Um das Agieren der US-Regierung auch nur ungefähr fassen zu können, muss man sich als erstes von der Vorstellung lösen, es gehe hier um eine zusammenhängende, in sich kohärente Politik. Die Trump-Unterstützer*innen, darauf weisen alle, die sich halbwegs auskennen, immer wieder hin, stehen für sehr widersprüchliche Interessen, die oft noch quer durch die einzelnen Personen gehen. Zum Beispiel haben einige ein Interesse an einem schwächeren Dollar, weil der Exporte billiger und Importe teurer macht, andere betonen die Bedeutung der Weltwährungsfunktion des Dollar, weil die eine problemlose Kreditaufnahme auch für den Staat ermöglicht.
Trump versucht, die widersprüchlichen Interessen seiner Klientel gleichzeitig zu bedienen, wobei dazu bedingt auch der Teil der Arbeiter*innen gehört, der sich die Industrieproduktion zurückwünscht. Darauf zielt die Zollpolitik durchaus und die Militärpolitik ebenfalls (weil sie zusätzliche Produktion und Nachfrage anregt). Auch hier muss sich die Linke von ihren eigenen Vorstellungen lösen, darf also nicht von einer traditionellen Kritik des Freihandels, des deindustrialisierenden Sozialabbaus oder einer Antikriegsposition her denken. Solche Kritik ist zwar moralisch gut begründet (was Trump nicht im Geringsten interessiert), aber inhaltlich weitgehend begriffslos, weil ihr jedes Verständnis von Krise fehlt.
Es lohnt ein Blick zurück
Freihandel ist der Protektionismus der Reichen und Mächtigen (Vandana Shiva) oder Freihandel ist, wenn einer auf einen Baum geklettert ist und den anderen die Leiter wegtritt (Friedrich List). Damit fängt die Globalisierungskritik etwa Ende der 90er-Jahre an. Diese Kritik nimmt nun Trump für sich selbst beziehungsweise die USA in Anspruch. Andere, vor allem China, aber auch Mexiko, Kanada, die EU, eigentlich alle, hätten die USA beim Freihandel übervorteilt und die müssten sich nun selbst schützen, um ihren fairen Anteil zurückzubekommen.
Und tatsächlich bezeichnet,,Globalisierung" ja einen Prozess, in dem transnationale Konzerne als Hauptakteure einer national entgrenzten Ökonomie Waren- und Finanzmärkte global nach Kostenvorteilen absuchen, um so ihr Produkt immer billiger anbieten zu können als die Konkurrenz. Damit stellen sie eine buchstäbliche „Weltwirtschaft" überhaupt erst her. Da Kapital, wenn es erfolgreich funktioniert, bei jeder Investitions- (= Produktions-) Runde größer ist als vorher, muss es immer weiter wachsen. Das sprengt nicht nur die räumlichen wie die mengenmäßigen Grenzen, sondern ver,wandelt auch immer mehr Lebensbereiche in Warenmärkte, die zum Teil, wie bei Wissen oder Kulturgütern, nur simuliert, also durch rechtliche Barrieren hergestellt sind. Gleichzeitig wird das Kapital nicht nur mehr, es wird auch produktiver, das heißt, die Menge der Produktion wächst schneller als die Menge des Kapitals.
Das war der Stand etwa zu Anfang/Mitte der 70er-Jahre des vorigen Jahrhunderts. Da fängt die globale Überproduktions- und Systemkrise an. Die wird aber nicht gelöst oder auch nur zugelassen, also dass sie sich austobt und ihr Werk vollbringt und überschüssiges Kapital vernichtet. Stattdessen beginnt die „Globalisierung", das heißt eine Wirtschaftspolitik, die darauf abstellt, jeden noch so überflüssigen, sinnlosen, schädlichen Produktionsprozess immer weiter auszudehnen, ohne dass jemand dieses Zeug wirklich braucht. Auch schafft sie Investitionsmöglichkeiten in bisher öffentlich organisierte Dienstleistungen, indem sie diese privatisiert, und vertröstet schließlich den verbleibenden Rest des Überschusskapitals auf die Zukunft, um es als fiktives, Kreditkapital, ,,Schulden", Ansprüche auf zukünftigen Wert bestehen zu lassen.
Keine Einzelerscheinung
Diese Entwicklung hält bis heute an, und ohne ein zumindest rudimentäres Verständnis, dass es sich hier um systemische Krisenerscheinungen handelt, ist das Phänomen Trump nicht zu begreifen. In der Düsseldorfer Erklärung hatte das globalisierungskritische Netzwerk Attac diesen Prozess 2008 genau beschrieben, auch andere hatten damals ein erstes Interesse an Krisentheorie entwickelt. An die Stelle dieses Einstiegs in eine systematische Kritik tritt heute meist wieder der reflexhafte Bezug auf die Sozialpolitik des Nachkriegskapitalismus. Diese war jedoch nicht zufällig in die Krise geraten und kann somit auch keine Lösung dafür sein. Das macht soziale Kämpfe nicht sinnlos; jeder Teil des Profits, der durch erfolgreiche Kämpfe in Mittel für das Gute Leben der Menschen verwandelt würde, verzögerte die Krisenentwicklung, hielte sie aber nicht auf.
Jedenfalls ist das, was Trump macht, lediglich der nächste Schritt der früher schon verfolgten sinnlosen und zerstörerischen Maßnahmen. Die Kernprobleme bleiben bestehen: Es gibt Überkapazitäten in unvorstellbarem Ausmaß, das heißt, von praktisch allen Gütern gibt es mehr, als die Menschen brauchen und vor allem kaufen können. Da gleichzeitig das Kapital wegen der Überproduktion tendenziell wenig profitabel ist, bestehen kaum Spielräume für eine großzügige Sozialpolitik. Im Gegenteil, wegen des Überangebots an Arbeitskräften und wegen der Profitklemme geht das Kapital immer öfter dazu über, die Löhne unter das Existenzminimum zu drücken. Jedenfalls bleiben die Kapitalmengen zu groß und werden zu schnell größer, eine Endlosschleife.
Dadurch nehmen immer größere Teile des gesellschaftlichen Gesamtkapitals die Form fiktiven Kapitals (,,Schulden") an, das das Realkapital bei weitem übertrifft, sich aber nur durch die Produktion wirklich realisieren kann. Da dort die fiktiven Profitraten höher sind als in der Produktion, geht davon eine Sogwirkung auf die Gewinnerwartungen des produktiven Kapitals aus. Eine weitere Endlosschleife.
Mehr oder weniger alle Dienstleistungen sind privatisiert und alles Denkbare ist in fiktive Waren verwandelt worden. Neue Branchen, von denen produktive Wunder erwartet worden waren, haben diesbezüglich nichts gebracht (Gentechnik, Digitalisierung). Man muss also zerstören, um neu aufzubauen: Raubrittertum erlebt in Gestalt der Kriegs- und Abrissunternehmer ein Revival und Krieg und Kettensäge begeben sich ebenfalls in eine Endlosschleife... Trump versucht mit allen Mitteln dafür zu sorgen, dass von all dem überflüssigen Mist möglichst viel in den USA bleibt oder dort wieder hinkommt. Dabei verwandelt er den Staat selbst in ein Raub- und Abrissunternehmen. Das kann aber nichts daran ändern, dass die Krise weitergeht, auch wenn vielleicht Teile seiner Klientel eine Weile lang den Eindruck haben könnten, sie hätten erfolgreich „gewirtschaftet".
Jede auch nur im Ansatz reflektierte Gegenposition müsste das Grundproblem im Auge behalten, nämlich dass viel zu viel Waren, viel zu viel Kapital, viel zu viel,,Reichtum" (der ja in Wirklichkeit oft nur die Verwandlung von Natur in sinnlose Produkte ist) da ist. Jede Forderung müsste darauf zielen, weniger, viel weniger zu produzieren und die materielle Absicherung der Menschen aus dem Kapitalverhältnis rauszunehmen und gesellschaftlich zu organisieren. Also nicht um Gegenzölle oder sowas geht es, auch nicht um die Verteidigung des Freihandels, nicht um den Schutz gefährdeter Wirtschaftsbereiche und auch nicht um den Erhalt von Arbeitsplätzen, sondern um das, was wir seit Langem soziale Infrastruktur und das Gute Leben nennen.
Hallo,
z.Zt. diskutiert ATTAC-Flensburg eine Bestandsaufnahme der aktuellen Umbrüche im Welthandel - wovon der auffällige neue US-Präsident nur ein Ausdruck ist.
Zu diesen Themen gehört das Programm der neuen Merz-geführten Bundesregierung, insbesondere ihre industrie- und handelspolitischen Implikationen. Es lohnt ein Blick bis zurück zu TTIP...
Dazu gehört auch ein beispielhafter Blick auf die "UN-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung" (wobei die taz im Titel nur die USA anprangert, während der Artikel selbst genauso die EU-Regierungen aufs Korn nimmt) sowie die Abkehr vom "Lieferkettengesetz".
Zum Diskussionsabend selbst lädt ATTAC-Flensburg gesondert ein (schaut hier: https://www.initiativkreis-flensburg.de/index.php/ueber-uns ).
Beste Grüsse, hn
Konjunkturpaket für die AfD
Das Programm von Schwarz-Rot schürt industriepolitisch die Illusion, es könne ein Weiter-so geben
Die deutsche Wirtschaft mit ihrer großen Autoindustrie steckt in der Krise. Wenn sich die Lage weiter verschlechtert, werden Wähler »wissen«, gegen wen sich ihr Ärger zu richten hat. Raul Zelik nd, 7 Min.
Friedrich Merz war am vergangenen Dienstag im ersten Wahlgang gerade erst gescheitert, da überschlugen sich Journalisten in Deutschland bereits in Appellen an Vernunft und staatsbürgerliche »Verantwortung« der Parlamentarier. Keine Rede mehr davon, dass Abgeordnete laut Grundgesetz »nur ihrem Gewissen unterworfen« sein sollen. Stattdessen hieß es plötzlich unisono: Wer die AfD stoppen will, muss jede Kritik zurückstellen und jetzt den Kanzler wählen.
Dabei wird in Wirklichkeit umgekehrt ein Schuh draus: Es ist die Wahl von Merz, die der AfD das Feld bereitet. Das kurze Aufbegehren am Dienstagmorgen war wie ein letztes Zucken der politischen Vernunft. Denn das Programm der neuen Bundesregierung liest sich wie ein Konjunkturpaket für die extreme Rechte. Industriepolitisch schürt es die falsche Illusion, es könnte so etwas wie ein Weiter-so für die Automobilnation Deutschland geben. Migrations- und sicherheitspolitisch hingegen macht es sich das AfD-Narrativ zu eigen, wonach die »irreguläre« Armutsmigration für die soziale Krise verantwortlich ist. Wenn sich die Wirtschaftskrise – wie zu erwarten – weiter verschärft, werden die Wähler »wissen«, gegen wen sich ihr Ärger zu richten hat. Besser kann es für die Faschisten kaum laufen.
Politik fürs Kapital
Dabei bemüht sich die Regierung Merz fast schon krampfhaft, Aufbruchstimmung zu verbreiten. Vor allem wirtschaftlich soll es endlich wieder aufwärtsgehen. So kreist das erste Drittel des 146-seitigen Koalitionsvertrags fast ausschließlich um die Frage, wie sich die Bedingungen für das Kapital so verbessern lassen, dass die Exporte wieder ins Rollen kommen. So sollen die Unternehmen durch »Bürokratieabbau«, die Absenkung der Energiekosten im Rahmen eines »Strompreispakets« und Steuersenkungen »entlastet« werden. Strafzahlungen im Rahmen von Flottengrenzwerten für CO2 wird eine Absage erteilt. Das Lieferkettengesetz, das ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in der Dritten Welt einen Riegel vorschieben sollte, soll wieder abgeschafft werden. Zudem legt man ein Bekenntnis zur Automobilproduktion als »Schlüsselindustrie und Arbeitsplatzgarant für unser Land« ab.
Weniger Bedenken gegenüber staatlichen Zwangsmaßnahmen zeigt die Koalition beim unteren Viertel der Gesellschaft. So soll das erst 2023 eingeführte Bürgergeld in eine »neue Grundsicherung für Arbeitssuchende« umgewandelt werden, mit dem man »Arbeitsanreize zu verbessern« sucht. Sprich: Mit bürokratischen Zwangsmaßnahmen will man dafür sorgen, dass Arbeitskräfte dem Niedriglohnsektor schnell wieder zur Verfügung stehen. Und auch in der Innen- und Sicherheitspolitik, in der nicht weniger als eine »Zeitenwende« angekündigt worden ist, gibt sich die Regierung Merz anpackend. Obwohl selbst die umstrittene »polizeiliche Kriminalitätsstatistik« des BKA eine seit 2010 relativ unverändert gebliebene Zahl an Straftaten in Deutschland konstatiert, schließt sich die schwarz-rote Koalition dem AfD-Narrativ an, dem zufolge die Sicherheitslage in Deutschland völlig außer Kontrolle zu geraten droht. Die »Große-Kontroll-Koalition« (wie Mathias Monroy sie in dieser Zeitung genannt hat) plant, die Vollmachten der Polizei zu erweitern, biometrische Fernidentifizierung sowie Staatstrojaner einzuführen und die Kooperation zwischen den Sicherheitsapparaten zu erleichtern.
Im Fadenkreuz der »Sicherheitsoffensive« steht – wie sollte es anders sein – die »irreguläre Migration«. Zwar will die Regierung zur »Sicherung der Fachkräftebasis« auch weiterhin »qualizifizierte Einwanderung« ermöglichen. Doch zur Abwehr ökonomisch weniger nützlicher Menschen werden alle erdenklichen Instrumente gezückt: Der Familiennachzug soll ausgesetzt, die Zurückweisung an Grenzen innerhalb der EU wiedereingeführt und eine »Rückführungsoffensive« gestartet werden, bei der man auf Masseninhaftierungen setzen will.
Die allgemeine Panikmache richtet sich auch gegen deutsche Staatsbürger mit ausländischer Familiengeschichte. So will die Regierung bei der »Clan-Kriminalität« eine »vollständige Beweislastumkehr beim Einziehen von Vermögen unklarer Herkunft« durchsetzen – was nichts anderes bedeutet als die Aufhebung der Unschuldsvermutung. In eine ähnliche Richtung geht die Ankündigung, dass zukünftig nicht nur Sprengstoff, sondern auch Messer als Gegenstände zur Vorbereitung terroristischer Anschläge betrachtet werden sollen.
Implosion der Mitte-Parteien
Auf diese Weise signalisiert die Regierung Merz den Wähler*innen, wer schuld daran ist, wenn sich die Wirtschaftskrise verschärft. Und letzteres wiederum ist in Anbetracht der strukturellen Probleme des deutschen Modells nur schwer zu vermeiden. Denn erstens wird die Exportorientierung Deutschlands aufgrund des neuen US-Protektionismus und wachsender geopolitischer Konkurrenz zusehends zum Problem. Zweitens haben deutsche Unternehmen bei der Transformation hin zu einem »elektrischen Kapitalismus« (wie die Politikwissenschaftlerin Birgit Mahnkopf das laufende Transformationsprojekt bezeichnet) gegenüber China den Anschluss verloren. Drittens schließlich gibt es eine Umwelt- und Klimakrise, die sich mittlerweile auch in steigenden Preisen und verknappenden Ressourcen niederschlägt. Ein wirtschaftspolitisches Weiter-so kann es hier gar nicht geben.
Man muss deshalb kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass die sozialen Abstiegsängste in der Gesellschaft weiter an Bedeutung gewinnen werden. Für die AfD ist das wie ein Geschenk, denn keine andere politische Kraft kann Verunsicherung so für sich nutzen wie sie. Ihr Programm der Realitätsverweigerung deckt sich mit der weitverbreiteten Sehnsucht nach der Bewahrung des Status quo. Schon in den 30er Jahren beruhte der Erfolg des Faschismus auf dem Versprechen, die Gesellschaft radikal zu verändern, ohne die grundlegenden Verhältnisse anzutasten. Ganz ähnlich läuft es auch heute wieder: Solange die politische Mitte alles unternimmt, damit über Kapitalismus und Verteilungsverhältnisse nicht gesprochen wird, kann die Krise nur der extremen Rechten zugutekommen.
Solange in der Bevölkerung die Illusion vorherrscht, mit Kampfjets ließen sich soziale Rechte verteidigen, werden Kürzungen auf breite Akzeptanz stoßen.
Sehr wahrscheinlich ist, dass die Entwicklung schon bald auch die Union selbst in eine Existenzkrise stürzen wird. Dass der besonders lobbyistensnahe CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann mit dem Hinweise, »er könne als Generalsekretär den Politikwechsel besser forcieren«, auf einen Ministerposten verzichtet hat, deutet darauf hin, wie sich die Unions-Rechte die Rollenverteilung der kommenden Jahre vorstellt. Bei jeder schlechten Nachricht wird sie für eine zusätzliche Rechtsverschiebung trommeln. Auch die »Brandmauer« zur AfD dürfte schon bald wieder zur Disposition stehen.
Ob dadurch der Zustimmungsverlust für die Union gestoppt werden kann, darf jedoch bezweifelt werden. Bisher ist die Kooperation mit rechtsextremen Parteien noch keiner bürgerlichen Partei in Europa gut bekommen. Fällt die Union dauerhaft hinter die AfD zurück, wie sich das in ersten Umfragen andeutet, sind erhebliche Absetzbewegungen zu erwarten. In Italien, Frankreich und den Niederlanden hat man in den letzten Jahren beobachten können, wie schnell die christdemokratischen und liberalkonservativen Staatsparteien zerfallen, wenn (neben) ihnen eine regierungsfähige Konkurrenz von rechts entsteht.
Beste Voraussetzungen für eine weitere Radikalisierung der bürgerlichen Mitte – laut Infratest/Dimap liefen bei den vergangenen Bundestagswahlen eine Million Wähler*innen von der Union, 890 000 von der FDP und 720 000 Stimmen von der SPD zur rechtsextremen AfD über.
Kürzungen, Klima, Polizei
Doch wie lässt sich dem Aufstieg der extremen Rechten etwas entgegensetzen, wenn von der politischen Mitte nichts zu erwarten ist? Der Gewerkschaftslinke Michael Ehrhardt (IG Metall) hat das Problem in einem Interview in dieser Zeitung in zwei Sätzen zusammengefasst: Wer die AfD stoppen wolle, müsse »beweisen, dass man sich erfolgreich mit den Reichen und Mächtigen anlegen und für Umverteilung sorgen kann. Das Schlüsselproblem heute ist, dass viele der Beschäftigten uns (den Gewerkschaften, Anm. d. V.) das nicht mehr glauben«.
Wichtigste antifaschistische Strategie in den kommenden Jahren wird deshalb sein, Umverteilungsfragen erfolgreich auf die Agenda zu setzen. Bei der Mietpreisentwicklung, die durch soziale Kämpfe (zuletzt vor allem die Kampagne Deutsche Wohnen & Co. enteignen), aber auch durch den Wahlkampf der Linkspartei thematisiert wurde, ist das in den letzten Jahren durchaus gelungen. Auf einen großen Arbeitskampf im öffentlichen Dienst hingegen, der die verheerende Lage der öffentlichen Daseinsvorsorge problematisieren und fast drei Millionen Beschäftigte mobilisieren hätte können, hat Verdi aus Zweifel an der eigenen Kampffähigkeit verzichtet.
An Anlass für Proteste wird es unter der neuen Regierung sicher nicht mangeln. Friedrich Merz hat schon vor einigen Wochen angekündigt, die »Zeiten des Paradieses« seien vorbei. Weil Steuererhöhungen ausgeschlossen werden, bleibt nur das Kürzungsdiktat. Widerstand dagegen wird sich aber nur entwickeln können, wenn die Proteste auch die Aufrüstungspolitik in den Blick nehmen. Solange in der Bevölkerung die Vorstellung vorherrscht, mit Kampfjets würden soziale Rechte und Freiheiten »von uns allen« verteidigt, werden Kürzungsmaßnahmen auf breite Akzeptanz stoßen. Dass es an der Seite von Rüstungskonzernen und Militärs noch nie irgendwo eine progressive Politik gegeben hat, ist im Augenblick auch in Gewerkschaften und Sozialverbänden leider keine weitverbreitete Erkenntnis.
Als zweites Mobilisierungsthema zurückkehren dürfte – mit den vorhersehbaren Extremwetterereignissen – schon bald auch wieder die ökologische Krise. Die Partei Die Linke wäre gut beraten, sich hier frühzeitig in Stellung zu bringen und die materialistische Dimension der großen Stoffwechselkrise verständlich zu machen. Der Klimawandel wird unter kapitalistischen Vorzeichen nicht gestoppt werden können und hat viel mit globalen Klassenverhältnissen zu tun. Die reichen zehn Prozent der Weltbevölkerung verursachen ihn, für die unteren Klassen stellt er eine existenzielle Bedrohung dar. Übrigens auch in den reichen Industrieländern, denn steigende Lebensmittelpreise werden auch hier die Armen vor Probleme stellen.
Ein drittes Feld schließlich, auf dem sich unter der neuen Regierung Proteste entzünden könnten, ist die Frage der staatlichen Repression. In Deutschland wird bislang eher wenig zur Kenntnis genommen, dass sich einige der wichtigsten Massenbewegungen der vergangenen Jahre gegen die Polizei richteten. Die Black-Lives-Matter-Proteste 2020 in den USA brachten zwischen 15 und 25 Millionen Menschen auf die Straße. In Frankreich kommt es nach Polizeimorden in den Banlieues regelmäßig zu Aufständen. Und auch die Abwahl der neoliberalen Regierungen Chiles und Kolumbiens 2022 war in erster Linie monatelang anhaltenden Anti-Polizei-Protesten geschuldet.
Der Fall des 21-jährigen Schwarzen Lorenz A., der Ende April in Oldenburg von der Polizei hinterrücks erschossen wurde, zeigt, dass das Problem in Deutschland nicht weniger ausgeprägt ist. 22 Personen wurden im vergangenen Jahr hierzulande von der Polizei erschossen – in Frankreich waren es im Skandaljahr 2023, als das ganze Land über die Erschießung des 17-jährigen Nahel Merzouk debattierte, dreizehn Fälle. Eine Studie der Universität Bochum ging 2019 von mehr als 12 000 Verdachtsfällen unrechtmäßiger Polizeigewalt in Deutschland aus.
Abolitionistische und migrantische Gruppen stellen das Phänomen in einen direkten Zusammenhang mit der Grenzpolitik. Die Aufrüstung der Polizeiapparate und die Abschottung der Grenzen seien zwei Seiten einer Medaille. Beide Maßnahmen richteten sich gegen eine Armutsbevölkerung, die häufig migriert ist, und besäßen in diesem Sinne einen klassenpolitischen Kern. Deshalb sei es auch kein Zufall, dass beide Themen im Programm der extremen Rechten eine Schlüsselrolle spielen.
Die 10 000 überwiegend migrantischen Menschen, die nach der Hinrichtung von Lorenz A. in Oldenburg auf die Straße gingen, und eine Reihe von Brandanschlägen, die in der ansonsten eher ruhigen norddeutschen Stadt auf Autos verübt wurden, machen deutlich, dass Polizeigewalt auch in Deutschland zunehmend Widerstand provoziert.
________________________________________________
Kaum gestartet, schon enttäuscht
Niemand findet den Koalitionsvertrag gut. Kein Wunder – denn die Koalition widmet sich einem Problem, das sie nicht lösen kann. Die Exportorientierung der deutschen Wirtschaft war früher eine Stärke, jetzt wird sie zur Last.
Stephan Kaufmann 5 Min.
Der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD wird nicht nur von links kritisiert. Auch Liberale, Rechte und Konservative, Unternehmen und ihre Verbände finden ihn »mutlos«. Tatsächlich wirken die Vorhaben der Koalition eher harmlos angesichts der gigantischen Aufgaben, vor die sie sich gestellt sieht. Die versprochene »Wende« beinhaltet der Vertrag nicht. Das allerdings ist wenig überraschend. Denn die Lösung der Probleme, mit denen der deutsche Standort derzeit konfrontiert ist, liegt zum Großteil außerhalb der Reichweite der Bundesregierung. Von der absehbaren Enttäuschung dürfte vor allem die AfD profitieren.
Die nächsten Jahre, so heißt es im Koalitionsvertrag, werden »maßgeblich darüber entscheiden, ob wir auch in Zukunft in einem freien, sicheren, gerechten und wohlhabenden Deutschland leben«. Denn das Land stehe vor »historischen Herausforderungen«. Gemessen an dieser Diagnose fallen die Bewertungen eindeutig aus: Der Koalitionsvertrag falle »hinter das Notwendige zurück«, kritisiert die Industrieverbands-Chefin Tanja Gönner. »Mehr Mut muss folgen«, fordert die Deutsche Industrie- und Handelskammer. Der Reformstau sei »nicht aufgelöst«, rügt die »Tagesschau«. Der Kommentator des Deutschlandfunks sieht im Koalitionsvertrag schlicht »nichts Neues«, und aus Sicht des Philosophen Jürgen Manemann fehle es der Politik an »Zukunftsvisionen«.
»Nicht genug«, lautet das allgemeine Urteil – nicht genug, um den strategischen Kern des Koalitionsprogramms zu erreichen: mehr Wirtschaftswachstum. Denn davon soll alles abhängen: die Aufrüstung, der Sozialstaat, der Klimaschutz, die Arbeitsplätze, der Wohlstand – und der Koalitionsvertrag selbst. Denn alle in ihm aufgeführten Maßnahmen stehen unter Finanzierungsvorbehalt »und daher unter Wachstumsvorbehalt«, erklärt der Ökonom Rudi Kurz auf dem Portal »Makronom«. Das heißt: Der Vertrag unterstellt das Wachstum, das er herzustellen verspricht.
Zwar dürften laut Ökonomen die kreditfinanzierten Ausgaben für Infrastruktur und Aufrüstung das Wachstum etwas anschieben. Einige geplante Steuer- und Energiepreissenkungen freuen auch die Unternehmen. Insgesamt aber sei der Vertrag »kein Wachstumsprogramm«, so die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer – ebenso wenig wie die vorangegangenen Programme der Ampel-Regierung.
Der globale Investitionsboom ist vorüber, heute herrschen in vielen Branchen Überkapazitäten und Nachfragemangel.
Dass sich die neue ebenso wie die vergangene Bundesregierung bei ihrem Kernziel so hilflos zeigt, liegt auch an der Lage, in der sich der Standort Deutschland befindet. Zum einen ist er besonders industrielastig; der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der Wertschöpfung liegt doppelt so hoch wie in Frankreich, Großbritannien oder den USA. Dies war in der Vergangenheit eine Stärke des Standortes, die ihm ab 2010 ein goldenes Jahrzehnt bescherte, während andere Euro-Länder durch die Krise manövrierten. Doch der globale Investitionsboom ist vorüber, heute herrschen in vielen Branchen Überkapazitäten und Nachfragemangel.
Auch die andere Stärke des Standortes wird zur Last: der Export. So werden 80 Prozent der deutschen Autos im Ausland abgesetzt. Eng wird der Weltmarkt zum einen durch die Zollpolitik der USA. »Ein Handelskrieg könnte Deutschland in den nächsten vier Jahren 200 Milliarden Euro kosten«, errechnet das Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Sämtliche Wachstumsprognosen für Deutschland hängen daran, dass US-Präsident Donald Trump seinen Zollkrieg nicht eskalieren lässt.
Dazu kommt der Aufstieg Chinas, das immer stärker zum Konkurrenten auf den Märkten innerhalb der Volksrepublik wie auch auf den deutschen »Heimatmärkten« wird. Chinas Exportpalette habe sich der deutschen weitgehend angeglichen, so eine Studie der Bank KfW. Daher sei »davon auszugehen, dass die Anstrengungen Chinas, sich intensiver in die globalen Wertschöpfungsketten einzubringen und mehr Wertschöpfung im eigenen Land zu generieren, für eine weitere Zunahme des Wettbewerbs mit Unternehmen in Deutschland sorgen« werden.
Gegen diese Entwicklungen hilft es wenig, wenn die Koalition Energie verbilligt, »Gründerschutzzonen« einrichtet, das Lieferkettengesetz kassiert und Arbeitslosen die Unterstützung streicht. Darüber hinaus ist unklar, wie eine laut Koalitionsvertrag notwendige »umfassende Erneuerung unseres Landes« überhaupt zu bewerkstelligen wäre. »Mehr Wachstum schaffen« sagt sich so leicht. Denn sämtliche weitergehenden Maßnahmen sind mit zahlreichen Widersprüchen behaftet.
So könnten die Mittel für staatliche Investitionen drastisch aufgestockt werden – doch woher soll das Geld kommen? Der Haushalt ist schon auf Kante genäht. Mehr Schulden wären eine Option – aber das könnte die Kreditwürdigkeit Deutschlands beschädigen, die bereits durch massive Aufrüstung strapaziert wird. Eine Verbilligung der Arbeit drückt zwar die Kosten für Unternehmen – kostet aber auch Nachfrage.
Steuersenkungen werden gefordert. Doch ihre Wachstumswirkungen sind umstritten, schon allein weil den deutschen Konzernen dank hoher Gewinne kaum Geld fehlt – was fehlt, ist die Nachfrage nach ihren Produkten. »Steuerliche Entlastungen für Unternehmen sind notwendig, aber sie allein werden Deutschland nicht wieder zu mehr Wettbewerbsfähigkeit verhelfen«, so das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Zudem kosten Steuersenkungen den Staat Geld – wo sollte gestrichen werden?
Als eine Art Wundertüte wird der Abbau der »Bürokratie« behandelt, wobei es sich im Koalitionsvertrag zum Großteil um eine Abschwächung des Klimaschutzes handelt. Das erspart den Unternehmen zwar Ausgaben. Gleichzeitig aber wachsen so zum einen die Kosten des Klimawandels. Zum anderen sinkt zum Beispiel durch die Förderung fossiler Industrien wie Verbrennerautos der Anreiz für die Unternehmen, in grüne Technologien und damit in Zukunftsmärkte wie E-Mobilität zu investieren, die zunehmend China erobert. Zölle gegen China wiederum schützen die deutschen Unternehmen zwar vor Konkurrenz, allerdings darf man es sich mit der zweitgrößten Ökonomie der Welt nicht verscherzen.
Sämtliche Wachstumsprognosen für Deutschland hängen daran, dass der US-Präsident seinen Zollkrieg nicht eskaliert.
In ihrem Bestreben, den Weltmarkt für mehr deutsches Wachstum zu nutzen, bleibt der Koalition also zunächst nichts übrig, als an allen verfügbaren Stellen die Bedingungen für Investoren zu verbessern, um so die »Wettbewerbsfähigkeit« des Standortes zu erhöhen. Dass dies automatisch zu mehr Wachstum führt, ist lediglich in den volkswirtschaftlichen Modellen der Fall. In der Realität kann sich zeigen, dass die »Bedingungen für eine wettbewerbsfähige und wachsende Volkswirtschaft« (Koalitionsvertrag) nicht identisch mit einer realen Wachstumsbeschleunigung sind.
Davon lässt sich die Politik allerdings nicht entmutigen. Absehbar ist daher erstens, dass die Bevölkerung künftig nicht nur zu mehr Arbeit und höherer Produktivität angehalten wird, sondern auch zum Verzicht bei Sozialleistungen, die bei den Unternehmen unter »Lohnnebenkosten« firmieren. »Der Koalitionsvertrag lässt leider jegliche Anstrengungen vermissen, das Ausgabenwachstum in der Rentenversicherung zu begrenzen«, sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter. Im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung bestünden »Leerstellen in Bezug auf dringend notwendige Reformen. Die Folge wird sein, dass die Sozialbeiträge weiter steigen. Damit werden die Bruttoarbeitskosten für die Unternehmen weiter steigen.«
Beim Sozialen dürfte also gespart werden. Dagegen ist für Aufrüstung mit der Reform der Schuldenbremse jede Summe verfügbar gemacht worden. Damit reagiert die Koalition nicht nur auf die wahrgenommene Bedrohung durch Russland. Sondern auch auf die Tatsache, dass die materiellen Grundlagen deutscher Macht – das Wachstum – zum Großteil abhängen von Entwicklungen jenseits der deutschen Grenzen, also im Bereich anderer Mächte. »Die Arbeitgeber begrüßen die Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes«, lobt die BDA den Koalitionsvertrag. »Die neuen geopolitischen Herausforderungen erfordern ein robustes Auftreten.«
Von der absehbaren Enttäuschung über die Ergebnisse der »Wirtschaftswende« der Koalition dürfte voraussichtlich vor allem die AfD profitieren. Denn wie alle rechten Parteien beklagt sie seit Langem und am lautesten eine existenzielle Krise der Heimat und verspricht eine radikale Wende. Im Angebot hat die Partei in dieser Hinsicht allerdings nichts – außer unfinanzierbaren Versprechen, einer aus dem »Leistungsprinzip« wachsenden Ungleichheit und der Zusage, die Lage Deutschlands zu verbessern, indem man Migrant*innen und das Ausland schlechterstellt.
Zölle, Freihandel und globale Machtspiele: Warum Trump nur die Oberfläche kratzt
Donald Trump liebt Zölle – das sagt er selbst. Doch so simpel seine Wortwahl auch sein mag, das Thema dahinter ist komplex. Wer heute über Zölle spricht, muss auch über Freihandel, Globalisierung und die Machtverhältnisse in der Weltwirtschaft reden. Denn die Frage ist nicht nur, ob Zölle gut oder schlecht sind – sondern: Für wen eigentlich?
Freihandel in der Theorie: ein Modell für alle?
Freihandel gehört zu den zentralen Vorstellungen der marktwirtschaftlich geprägten Ökonomie. Die Grundidee ist einfach und wirkt einleuchtend: Jeder soll das herstellen, was er oder sie am besten kann. So entsteht insgesamt die effizienteste Produktion – zum Wohl aller. Diese Theorie klingt einleuchtend, ist aber so simpel wie viele andere Glaubenssätze der Marktwirtschaft.
David Ricardo formulierte sie Anfang des 19. Jahrhunderts: Wenn Länder unterschiedliche Voraussetzungen und Fähigkeiten haben, dann sollten sie sich auf das konzentrieren, was sie am besten beherrschen. (isw-spezial 33, 2020) So ließen sich weltweit möglichst viele hochwertige Güter zu möglichst geringen Kosten herstellen und durch freien Handel optimal verteilen. Zölle gelten dabei als ineffizient, weil sie den Wettbewerb verzerren. Sogar moderne Ökonom*innen stimmen in diesem Punkt meist überein. Die Süddeutsche Zeitung etwa schrieb: „Freier Handel erhöht den Wohlstand … Werden Zölle gesenkt, steigt der Wohlstand in allen beteiligten Ländern“ (3.4.2025).
Freihandel in der Praxis: eine naive Annahme
Das Problem der Theorie liegt in einer stillschweigenden Grundannahme: dass alle Arbeitskräfte und Produktionsmittel weltweit vollständig ausgelastet sind. Dahinter steckt die Vorstellung, dass in einer Marktwirtschaft jede*r, der arbeiten will, auch Arbeit findet. Doch in der Realität gibt es in fast allen Ländern – besonders in ärmeren – strukturelle Arbeitslosigkeit.
Fällt diese Annahme weg, verliert auch Ricardos Modell seine Gültigkeit. Dann konzentriert sich Arbeitslosigkeit vor allem in den schwächeren Volkswirtschaften: Wer nicht konkurrenzfähig ist, verliert. Starke Länder bauen ihren Vorsprung weiter aus – durch überlegene Technologie, bessere Bildung, leistungsfähige Infrastruktur. Schwächere Länder geraten ins Hintertreffen, Produktion und Jobs wandern ab, Armut nimmt zu.
Zwar kann Freihandel zu günstigeren Produkten führen – doch für viele Menschen in schwächeren Ländern bedeutet das den Verlust ihrer Arbeitsplätze und damit ihres Einkommens. In der Folge hilft ihnen auch der Zugang zu billigeren Waren nichts. Aus ihrer Perspektive kann Protektionismus – also die gezielte Förderung der eigenen Industrie – sinnvoller sein, auch wenn er teurere Produkte bedeutet.
Ein bekanntes Beispiel: In vielen Entwicklungsländern wurden einfache, handwerklich produzierte Schuhe durch billige Plastiksandalen aus dem Ausland verdrängt. Die lokale Produktion brach ein, Arbeitsplätze verschwanden. Oder: Europäische Fleischkonzerne exportierten Abfallprodukte wie Hühnerflügel oder Innereien zu Spottpreisen nach Afrika – mit dem Effekt, dass lokale Kleinbetriebe in der Geflügelzucht aufgeben mussten. Die Folge: Mehr Arbeitslosigkeit, weniger Einkommen, mehr Armut.
Die zentrale Frage lautet daher: Wohin fließt das Geld in einer globalisierten Welt – in die Konzernzentralen der reichen Länder oder auch in die Regionen, die bislang wenig vom Handel profitiert haben?
Erziehungszölle: Schutz für aufstrebende Industrien
Für viele Länder mit schwacher Wirtschaft war schnell klar: Freihandel hilft vor allem den Starken. Die Idee der sogenannten Erziehungszölle entstand deshalb aus der Notwendigkeit, junge Industrien vor der übermächtigen Konkurrenz zu schützen. Ziel war es, Industrien in Ländern mit Rohstoffen zu fördern – etwa durch Zölle auf importierte Waren, die man auch selbst herstellen könnte: Schuhe, Lederprodukte, verarbeitete Lebensmittel, Textilien, später vielleicht sogar Stahl.
Die Einnahmen aus den Zöllen sollten dabei direkt in den Aufbau der Industrie fließen. Doch in der Praxis verhinderten die reichen Länder, oft unterstützt durch internationale Institutionen, dass dieses Modell konsequent umgesetzt werden konnte. Selbst Staaten mit großem wirtschaftlichem Einfluss, wie Saudi-Arabien, brauchten Jahrzehnte, um ihre Ölwirtschaft auf eine eigene Weiterverarbeitung umzustellen.
Einige Länder – zum Beispiel Indien – setzen dennoch bis heute auf hohe Zölle, etwa im Automobilbereich, um die eigene Produktion zu fördern. Auch im Gründungsvertrag der Welthandelsorganisation (WTO) sind Ausnahmeregeln für solche Schutzmaßnahmen vorgesehen. Doch der große Durchbruch dieses Modells blieb bisher aus – vor allem für die breite Masse ärmerer Länder.
Freihandel als Machtinstrument
Die reichen Länder, besonders exportstarke wie Deutschland, setzten sich nach dem Zweiten Weltkrieg massiv für den Abbau von Handelshemmnissen ein – Zölle, Mengenbeschränkungen, technische Normen oder Patentschutz sollten weltweit reduziert werden. Das Ziel: Zugang zu neuen Märkten, stärkere Marktanteile für die eigene Industrie, Verdrängung der Konkurrenz.
Nach jahrzehntelangen Verhandlungen wurde 1995 die WTO gegründet. Ihr Prinzip: Handelsbarrieren sollten nur noch abgebaut, nicht wieder aufgebaut werden. Doch der sogenannte Freihandel blieb ein komplexes Gefüge voller Sonderregeln und Ausnahmen. Besonders Kuba war – trotz aller Freihandelsrhetorik – weiterhin massiven Sanktionen ausgesetzt. Andere Länder kämpften regelmäßig mit Schuldenkrisen, verursacht durch eine zu schnelle Öffnung ihrer Märkte und den damit einhergehenden Verlust wirtschaftlicher Eigenständigkeit.
TTIP: Der Freihandel als strategische Waffe
Wer erinnert sich noch an TTIP? Das geplante Handelsabkommen zwischen den USA und der EU sollte nicht nur wirtschaftliche Vorteile bringen, sondern auch geopolitisch wirksam sein – vor allem gegenüber dem aufstrebenden China. Ziel war es, globale Standards zu setzen, die für China schwer zu erfüllen wären. (isw-report 97, 2014)
Doch TTIP scheiterte – an inneren Spannungen und am öffentlichen Widerstand. Das Ziel, China zu bremsen, blieb jedoch bestehen. Statt über Handelsabkommen setzt man heute auf Zölle, Exportverbote, Investitionsverbote und andere Maßnahmen, die dem Freihandelsgedanken widersprechen. China ist allerdings kein schwacher Akteur – anders als Kuba kann es Gegenmaßnahmen ergreifen.
Zölle out – Kapitalverkehr in
Während der freie Warenhandel heute weitgehend zur Normalität geworden ist (Zölle sind meist niedrig, innerhalb der EU sogar abgeschafft), hat ein anderer Bereich die Bühne betreten: der freie Kapitalverkehr.
Konzerne und ihre Regierungen fordern zunehmend ungehinderten Zugang zu globalen Investitionsmöglichkeiten – möglichst ohne staatliche Eingriffe. Kapital, Technik und Management sollen dorthin fließen, wo Arbeitslöhne niedrig sind. Für diese Investitionen erwarten die Unternehmen größtmögliche Sicherheit: Sie wollen ihr Kapital bei Bedarf schnell wieder abziehen können, ihre Gewinne ins Heimatland transferieren, ihre Standorte selbst wählen.
In den letzten Jahrzehnten wurde diese Form der Globalisierung stark vorangetrieben. Die Folge: Multinationale Konzerne profitieren, lokale Bevölkerung und Umwelt nicht unbedingt. Ein Beispiel ist Nigeria – reich an Rohstoffen, aber geplagt von Umweltzerstörung und Armut in den Förderregionen.
Weltwirtschaft bedeutet heute: ein globaler Markt mit möglichst einheitlichen Regeln – vor allem im Sinne der großen Unternehmen. Es geht längst nicht mehr nur um den Export von Waren, sondern um Standortkonkurrenz, Subventionen, Deregulierung und maximale Freiheit für Kapital und Konzerne.
https://www.isw-muenchen.de/
Nachhaltige Entwicklungsziele der UN: Die USA blockieren globale Finanzreformen
Im Vorfeld der UN-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung wollen die USA Wörter wie „Klima“ streichen. Zivilorganisationen kritisieren auch die EU.
BERLIN taz | Handelsbarrieren, niedrige Rohstoffpreise, teure Kredite, hohe Verschuldung: Viele Entwicklungsländer sehen sich von der internationalen Handels- und Finanzarchitektur benachteiligt. Die Regeln dafür werden in Foren gemacht, in denen sie unterrepräsentiert sind oder gar kein Mitspracherecht haben – im Internationalen Währungsfonds oder dem Industriestaatenverbund OECD etwa.
Um das zu ändern, wollen sie bei den Vereinten Nationen verhandeln. Zum Beispiel über den Zugang zu Kapital, gerechte Besteuerung und einen Rahmen für Staatsinsolvenzen. Ende Juni findet das wichtigste Forum dafür in Sevilla, Spanien, statt: die 4. Internationale Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung (FFD4).
Wie sehr die Reformvorhaben vor allem im Globalen Norden auf Widerstand stoßen, zeigte sich auch in dieser Woche bei vorbereitenden Gesprächen in New York. Die USA galten schon lange als Blockierer – auch unter Ex-Präsident Joe Biden. Die Regierung unter Donald Trump setzt nun eins oben drauf. Die US-Amerikaner wollen Begriffe wie „Klima“, „Gleichstellung der Geschlechter“ und „Nachhaltigkeit“ aus dem Reformentwurf streichen, der im Sommer in Spanien diskutiert wird.
So geht es aus einem internen Dokument hervor, über das Reuters berichtete. Demnach wollen die USA auch nicht, dass Unternehmen dort Steuern zahlen, wo sie wirtschaftlich tätig sind, was Entwicklungsländern zugutekäme. Ebenso soll der Abbau ineffizienter Subventionen für fossile Brennstoffe nach Wünschen der USA kein Ziel im Abschlussdokument der FFD4 sein.
UN-Entwicklungsziele stehen auf der Kippe
Um die UN-Ziele zur nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, denen sich die Staatengemeinschaft 2015 verpflichtet hat, braucht es neue globale Regeln, fordern viele Entwicklungsländer und Zivilorganisationen. Den Zielen zufolge soll weltweit der Hunger beseitigt werden, sollen alle Menschen Zugang zu Gesundheit und Bildung haben – bis 2030. Laut UN gab es bislang jedoch nur bei 17 Prozent der Ziele überhaupt Fortschritte.
Den Staatskassen der Entwicklungsländer fehlt das Geld. Und die Bereitschaft aus dem Globalen Norden, Ressourcen in Entwicklungsfinanzierung zu stecken, sinkt. Viele Geberstaaten schrumpfen ihre Entwicklungsetats. Umso wichtiger wären nun Zugeständnisse zu zentralen Reformen. Die sollen zum Beispiel den Abfluss von Geldern aus Entwicklungsländern an reiche Länder verringern, der etwa durch hohe Schuldendienste oder Steuervermeidung von multinationalen Konzernen entsteht. Auch wenn UN-Beschlüsse am Ende unverbindliche Empfehlungen sind, gelten sie als wichtiges politisches Signal für strukturelle Reformen.
Bereits im März erteilten die USA den Vereinten Nationen in einem offiziellen Statement jedoch eine klare Absage. Die UN sei nicht die richtige Institution, um Steuern, Schulden und Handel zu besprechen, hieß es. „Einige Empfehlungen greifen in die Souveränität der Staaten und die Unabhängigkeit anderer Organisationen ein, darunter die WTO, die OECD und internationale Finanzinstitutionen.“
EU setzt auf Investitionen statt Reformen
Die EU hat vor Kurzem ihre Unterstützung für die UN-Konferenz wiederholt und dafür geworben, „auf ein ehrgeiziges Ergebnis hinzuarbeiten“. Rund 200 Zivilorganisationen wandten sich vergangene Woche jedoch mit Kritik an europäische Politiker*innen. Diese haben sich bei den Verhandlungen im Vorfeld der Konferenz „bisher jeder sinnvollen Reform widersetzt“, schrieben sie.
„Die EU verteidigt einen ungerechten Status quo“, sagte Jean Saldanha der taz. Sie ist Direktorin von Eurodad, einem europäischen zivilgesellschaftlichen Netzwerk zu Entwicklung und Verschuldung. Die EU wolle etwa weiterhin auf den Internationalen Währungsfonds und den Schuldenrahmen der G20 bestehen, um auf Schuldenkrisen zu reagieren. „Beide haben sich als unzureichend und langsam erwiesen und schützen die Interessen der Gläubiger“, so Seldanha.
Statt Reformen hebe die EU ihre Investitionen in Infrastruktur im Rahmen des Global-Gateway hervor. Das räume den „geopolitischen Interessen der EU Vorrang vor nachhaltigen Entwicklungsergebnissen ein“, kritisiert Seldanha.
Wie die USA betont auch die EU, dass es wichtig sei, privates Kapital zur Schließung der Finanzierungslücke von Entwicklungsländern zu mobilisieren. Doch für Entwicklungsländer ist privates Kapital im aktuellen System teuer. Laut der UN-Handels- und Entwicklungskonferenz Unctad zahlen Entwicklungsländer bis zu 4-mal mehr für Kredite als die USA und sogar 6- bis 12-mal mehr als Deutschland.
Ende vergangenes Jahr räumte die Weltbank ein, dass private Gläubiger 2022 fast 141 Milliarden US-Dollar mehr an Schuldendienstzahlungen von Entwicklungsländern erhielten, als sie diesen in neuen Investitionen zur Verfügung gestellt hatten. Kurzum: Während die Investitionen privater Geldgeber längst Gewinne abwerfen, leiden Entwicklungsländern unter den hohen Schuldendiensten.
Laut Unctad leben über 3 Milliarden Menschen in Ländern, die mehr für die Rückzahlung von Krediten und Zinsen als für Gesundheit und Bildung ausgeben. Sie fordern deshalb etwa eine Revision der Ratingagenturen. Und dass multilaterale Entwicklungsbanken Kredite in nationalen Währungen ausgeben.
Das Lieferkettengesetz.
Ein Trauerspiel in 5 Akten
Sollen Menschenrechte nur in deutschen Fabriken gelten? Oder auch in Fabriken, die für Deutsche arbeiten? Das wollen manche unbedingt verhindern.
Mehr als 4 Millionen Menschen arbeiten in Bangladesch in der Textilindustrie. Viele von ihnen zu menschenunwürdigen Bedingungen.Prolog – Im Bundestag
„Nie wieder Rana Plaza“ – so leitete Entwicklungsminister Gerd Müller seine Rede im Parlament ein. Das war am 11. Juni 2021. Acht Jahre zuvor waren über 1.100 vor allem weibliche Beschäftigte beim Zusammenbruch des Rana-Plaza-Fabrikgebäudes bei Dhaka, Bangladesch, gestorben. Sie hatten auch für deutsche Unternehmen und Geschäfte genäht.
Der bayerische Katholik und CSU-Politiker Müller zog daraus die Konsequenz, so etwas künftig mit einem Gesetz verhindern zu müssen. Der Bundestag beschloss das Gesetz schließlich. Union, SPD und Grüne stimmten dafür, FDP und AfD dagegen. Die Linken enthielten sich. Jetzt will Müllers Partei das Gesetz wieder abschaffen, zusammen mit CDU und SPD.
Die Geschichte des Lieferkettengesetzes handelt von etwas ganz Einfachem: den Menschenrechten, die keinem Individuum genommen werden dürfen und die ganz vorne im Grundgesetz stehen. Müllers Gesetz legte fest, dass diese Rechte nicht nur in deutschen Fabriken gelten sollten, sondern auch in ausländischen, die für Deutsche arbeiten.
Aber viele Firmen, große Wirtschaftsverbände und konservative Politiker wollten dieses Gesetz immer verhindern. Erst waren sie in der Defensive, jetzt sind sie in der Offensive. Eine Tragödie in fünf Akten.
1. Akt – Die Katastrophe
Das achtgeschossige Fabrikgebäude Rana Plaza stürzte im April 2013 ein, weil man es schlecht gebaut hatte. Verantwortlich waren die Besitzer, mitverantwortlich die ausländischen, auch deutschen Unternehmen, die weggeschaut hatten.
Nach dem Zusammensturz war die internationale Entrüstung enorm. Rana Plaza zeigte, wie die Globalisierung funktionierte. Schlechte Löhne, gesundheitsschädliche oder tödliche Arbeitsbedingungen und niedrige Kosten in den ausgelagerten Zulieferfabriken armer Länder ermöglichten günstige Verbraucherpreise in reichen Staaten. So etwas per Gesetz zu unterbinden, forderte deshalb bald eine breite Bewegung, die von der unabhängigen Linken über Gewerkschaften und Kirchen bis zu den Christlich-Konservativen reichte.
2. Akt – Das Gesetz
Gerd Müller und sein SPD-Kollege Hubertus Heil versuchten über die Jahre einiges, um auch die deutschen Unternehmen und ihre Verbände von diesem Anliegen zu überzeugen – zunächst mit freiwilligen Angeboten wie dem Bündnis für nachhaltige Textilien und dem Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte. Doch die meisten Firmen verweigerten sich.
Deshalb entwarfen die Politiker das verpflichtende Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Gesetz. Darin steht, dass die hiesigen Auftraggeber eine Mitverantwortung für die Arbeitsverhältnisse in ihren Zulieferfabriken haben, dieser Verantwortung gerecht werden müssen, und ihnen bei Missachtung Sanktionen drohen. Es gilt für alle Unternehmen mit mindestens 1.000 Beschäftigten.
Große Wirtschaftsverbände wie BDI, BDA, DIHK, Gesamtmetall oder Textil & Mode versuchten immer wieder, das Gesetz zu schwächen, zu verzögern und zu verhindern. Ihre Argumente: Die Überprüfung teilweise tausender Lieferanten sei für die Unternehmen zu aufwändig und zu teuer, außerdem dürften deutsche Firmen gegenüber ihren ausländischen Konkurrenten nicht benachteiligt werden.
3. Akt – Europas Standard
Mit ihrer Warnung vor Wettbewerbsnachteilen stießen die deutschen Wirtschaftsverbände und Politiker auf Verständnis der Europäischen Kommission – allerdings anders als erhofft. Unter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erarbeitete die EU selbst eine Lieferketten-Richtlinie, die etwas strengere Regeln als das deutsche Gesetz für alle großen in- und ausländischen Unternehmen in den 27 Mitgliedstaaten festlegte.
Dagegen setzten die hiesigen Verbände und FDP-Bundesfinanzminister Christian Lindner alle Hebel in Bewegung – weitgehend erfolglos: Die Richtlinie, ein neuer internationaler Standard, wurde am 24. Mai 2024 beschlossen.
4. Akt – Die Gegenbewegung
Inzwischen hat sich aber die Großwetterlage geändert. Im Gegensatz zu den ökonomisch guten 2010er Jahren steckt die deutsche Wirtschaft in einer Stagnation und Krise ihres Import-Export-Modells. Auch Firmen in anderen EU-Ländern machen sich Sorgen. Die russische und chinesische Autokratie sowie die antiliberale US-Regierung erschweren den internationalen Handel.
Nach der Neuwahl des EU-Parlaments, in dem seither auch die Rechtsextremen stärker sind, will von der Leyens zweite Kommission der Wirtschaft entgegenkommen. Anfang 2025 schlägt sie vor, dass die Unternehmen nur noch für ihre direkten, also weniger Lieferanten mitverantwortlich sein sollen, ihre Haftung beschränkt und das Inkrafttreten der Richtlinie verschoben wird.
5. Akt – Zurück auf Los
In Berlin bildet sich eine Bundesregierung aus Union und SPD. Diese will das deutsche Lieferkettengesetz nicht mehr anwenden, bis die EU ihre neue Richtlinie beschlossen hat. Wirtschaftsverbände, viele Unternehmen, Union, FDP und AfD werden derweil daran arbeiten, dass die künftige EU-Regelung möglichst schwach ausfällt.
Bis dahin herrscht ein regelloser Zustand wie vor dem Beschluss des deutschen Gesetzes. Den Unternehmen bleibt es selbst überlassen, ob sie ihre Verantwortung für die Menschenrechte wahrnehmen. CSU-Minister Gerd Müller hat umsonst gearbeitet. Katastrophen wie Rana Plaza werden wieder wahrscheinlicher.
..... weitere Lese-Tipps:
- Mail von Birte, 24.04.2025, um 06:00 mit diesem Link:
https://umweltinstitut.org/welt-und-handel/meldungen/energiecharta-vertrag-schweizer-staatsunternehmen-klagt-gegen-deutschen-kohleausstieg/?tw_cid=69&utm_medium=newsletter
- Mail von Birte, 07.05.2025, um 06:51 mit diesem Link:
https://www.focus.de/politik/analyse/tiefseebergbau-trump-entsetzt-mit-neuem-ozean-plan-niemand-wird-das-je-reparieren-koennen_2aec5d44-203d-482b-8730-a2e7b878f28e.html
____________________________________________________
Im Gespräch. Union und SPD wollen Hunderte Milliarden zusätzlich für Rüstung ausgeben. Außenpolitikexperte August Pradetto hält dagegen: Das sei militärisch kontraproduktiv.
Von Dorian Baganz Der Freitag - 13.03.2025
Das Sondierungspapier der in den Startlöchern stehenden schwarz-roten Koalition spricht eine klare Sprache: „Unser Ziel ist es, die innere und äußere Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu stärken." Konkret sollen alle Militärausgaben, die über einem Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) liegen, künftig von der Schuldenbremse ausgenommen sein; ein Gegenvorschlag der Grünen schlägt 1,5 Prozent des BIP vor. Der Politikwissenschaftler August Pradetto hält das für unnötig.
der Freitag: Herr Pradetto, wie blicken Sie auf die Aufrüstungspläne von Schwarz-Rot?
August Pradetto: Ganz prinzipiell gilt: Deutschland und Europa brauchen eine eigene und gut aufgestellte Verteidigungsfähigkeit. Jedes Land und die europäischen Staaten kollektiv müssen in der Lage sein, sich militärisch zur Wehr zu setzen, wenn eines von ihnen angegriffen wird. Das ist nach dem Wegfall der US-Garantien umso wichtiger. Was fehlt, ist eine Analyse, was Landes und europäische Bündnisverteidigung im Jahr 2025 und in den nächsten Jahren heißt. Denn Russland ist zwar ein militärischer Gegner für die Ukraine, aber kein wirklicher militärischer Gegner mehr für die NATO. Putin hat in diesem Krieg nicht nur die Ukraine zerstört, sondern auch seine eigenen Streitkräfte.
August Pradetto - (geboren 1949) ist ein emeritierter deutscher Politikwissenschaftler. 1992 wurde er an die Universität der Bundeswehr in Hamburg berufen. Über den Ukrainekrieg schrieb er unter anderem in den Blättern für deutsche und internationale Politik
Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, behauptet: Russland wird in fünf Jahren in der Lage sein, das NATO-Gebiet anzugreifen.
Das halte ich für eine Fehleinschätzung. Die russischen Streitkräfte sind trotz höchster Anstrengung in den letzten drei Jahren gegen die vergleichsweise schwache ukrainische Armee nicht weiter als 100 Kilometer vorgedrungen und dort stecken geblieben. Praktisch alle Truppen mussten aus dem Fernen Osten an der japanischen und chinesischen Grenze wie an der langen NATO-Grenze zu Finnland abgezogen und in die Ukraine gebracht werden, um die gigantischen Verluste zu kompensieren. Die russischen Streitkräfte
sind heute in der prekärsten Lage seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Laut BBC sind 220.000 russische Soldaten und 4.595 Befehlshaber in der Ukraine gestorben, dazu kommen Hunderttausende Versehrte. Ein groBer Teil des Materials, das Moskau für einen Landkrieg einsetzen konnte, ist vernichtet. Das heißt, der gesamte Kern der russischen Streitkräfte ist in diesem Krieg zerschlagen worden. Russland wird Jahre brauchen, um auch nur seine eigene Verteidigungsfähig keit wiederherzustellen.
Was bedeutet das für unsere Sicherheitspolitik?
Wir müssten erst mal eine Bedrohungsanalyse vorlegen, die nicht auf irgendwelchen Fantasien russischer Nationalisten über die Wiederherstellung der Sowjetunion basiert, sondern auf militärischen und ökonomischen Fakten. Die Wirtschaftsleistung Russlands ist die von Italien oder Spanien: Das ist die Basis für Kriegswaffenproduktion und militärischen Aufwuchs. EU- und NATO-Europa steht unvergleichlich besser da.
Die Ostflanke der NATO ist mittlerweile gut gesichert, an die 20 Nationen arbeiten dort militärisch zusammen und schrecken erfolgreich ab. Deutschland will 4.800 Soldaten in Litauen stationieren, ein Teil ist schon dort. Die NATO ist Russland also auch im Osten haushoch überlegen. Gegen die NATO kann Russland heute im Wesentlichen nur noch hybrid Krieg führen, nicht konventionell. Was Russland heute sichert, ist nur noch die Drohung mit seinen Nuklearwaffen. Die gegenwärtigen Panikkäufe sind enorme Geldverschwendung.
„Russlands Armee ist in der prekärsten Lage seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die NATO ist haushoch überlegen."
40 Prozent der Waffen, die die Ukraine im Krieg einsetzt, kommen aus den USA. Welche Folgen hat es, dass Trump die Lieferungen eingestellt hat?
Das ist fast die Hälfte, also schon ein erheblicher Teil. Natürlich wird das die ukrainische Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen, stark be-einträchtigen. Wenn dann auch noch die Kommunikations- und Aufklärungskapazitäten der USA wegfallen, ist das eine dramatische Situation für das Land. Der Druck auf Kiew, zu einem Ende des Krieges zu kommen, steigt dadurch ganz erheblich. Und das hat auch Folgen für die EU: Die europäische Ukrainestrategie muss sich jetzt verändern. Schließlich wissen die Europäer, dass sie die amerikanische Unterstützung kurzfristig nur unzureichend ersetzen können. Wenn die noch amtierende Außenministerin Annalena Baerbock weiterhin sagt: Die Ukraine muss so lange von uns militärisch unterstützt werden, bis sie aus einer Position der Stärke in Verhandlungen einsteigen kann, dann ist das Gerede von gestern.
Friedrich Merz hat kürzlich eben-falls gesagt: „Die Ukraine muss die Systeme bekommen, die sie zu ihrer Verteidigung benötigt, auch Marschflugkörper."
Die Ukraine muss bis zu einem Waffenstillstand weiter bei der Verteidigung ihres Territoriums unterstützt werden, aber der Taurus ist eine Debatte von gestern. Herr Merz hinkt der politischen Entwicklung hinterher. Nach der Kehrtwende in den USA will der größte Teil der Politiker in den europäischen Ländern sich umso weniger in einen Krieg mit Russland verwickeln lassen. Emmanuel Macron und Keir Starmer sind schon einen Schritt weiter: Sie stellen sich und uns auf eine Nachkriegssituation ein und reden mit der amerikani-schen Administration darüber, zu welchen Bedingungen der Krieg zu einem Ende kommen kann. Ich wage die These: Da wird unser Kanzler in spe auch noch hinkommen.
Ursula von der Leyen will auf EU-Ebene 800 Milliarden Euro für Aufrüstung mobilisieren.
Der gegenwärtige Panikmodus und der Überbietungswettbewerb in Fragen der Aufrüstung ist völlig verfehlt. Wir können ganze ruhig die notwendigen Schwerpunkte bei der kollektiven Verteidigung der europäischen Länder setzen. Die NATO in Europa ist auch ohne die USA Russland konventionell weit überlegen. Was die Europäer brauchen, wenn die USA als Verbündeter ausfallen, ist ein eigenes Kommunikations- und Aufklärungssystem vor allem über Satelliten. Und zweitens: militärische Transportkapazitäten, also Groß-raumtransporter. Das Satellitensystem können sie ohne übermäBige Anstrengungen in den kommenden Jahren aufbauen, europäische Firmen können das bewerkstelligen. Die Transportflugzeuge können zum Beispiel von den USA gekauft werden. Außerdem sind die Lehren aus dem Ukrainekrieg zu ziehen.
Welche sind das?
Neben Patriot-Systemen und ähnlichem sind Drohnen die Abwehrwaffen der Zukunft, nicht Panzer und Kampfflugzeuge. Der vom Verteidigungsministerium schon 2022 in die Wege geleitete Kauf von sündteuren F-35 Kampf-flugzeugen von den USA ist ein Fehlkauf, genauso wie die Massenbestellung von Panzern. Ein Panzer, der 20 oder 25 Millionen Euro kostet, kann von einer 350-Euro-Drohne außer Gefecht gesetzt werden. Die gegenwärtigen Panikkäufe sind also nicht nur Geldverschwendung, sondern militärisch auch noch äußerst kontraproduktiv. Eine adäquate Ausstattung unserer Streitkräfte muss ohne Zweifel gewährleistet sein. Aber um Deutschland und Europa sicher zu machen, muss viel mehr in Bildung, Innovation, Zukunftstechnologien, Infrastruktur, den Kampf gegen den Klimawandel und in die Kohäsion Europas investiert und eine solide Haushaltsführung beachtet werden.
Das Dümmste, das wir machen können, ist, uns selbst totzurüsten.
Kampagne gegen die geplante Stationierung von Angriffswaffen in Deutschland formiert sich
von: Jürgen Wagner | Veröffentlicht am: 7. Januar 2025 - IMI-Standpunkt 2025/001
Immer wenn im Westen von Fähigkeits- oder Raketenlücken gesprochen wird, ist allergrößte Vorsicht geboten. Nur allzu oft stellten sich Behauptungen über die Hochrüstung erklärter Gegner als glatte Lüge oder zumindest als grobe Übertreibungen heraus, um die eigenen Rüstungsbestrebungen zusätzlich zu befeuern. So auch im jüngsten Fall, der geplanten Stationierung von US-Mittelstreckwaffen in Deutschland, deren katastrophalen Folgen sich schon jetzt immer deutlicher abzeichnen. Umso wichtiger ist es, dass sich allmählich unter anderem mit der Kampagne „Friedensfähig statt erstschlagfähig!“, an der sich auch die Informationsstelle Militarisierung (IMI) beteiligt, auch der Widerstand dagegen formiert.
Fähigkeitslücke…
Auffällig ist zunächst, wie dünn die gerade einmal vier läppischen Sätze daherkommen, mit denen eine deutsch-amerikanische Erklärung vom 10. Juli 2024 das Vorhaben angekündigte, ab 2026 diverse US-Mittelstreckensysteme hierzulande für die „Abschreckung“ zu stationieren: „Die Vereinigten Staaten von Amerika werden, beginnend 2026, als Teil der Planung zu deren künftiger dauerhafter Stationierung, zeitweilig weitreichende Waffensysteme ihrer Multi-Domain Task Force in Deutschland stationieren. Diese konventionellen Einheiten werden bei voller Entwicklung SM-6, Tomahawks und derzeit in Entwicklung befindliche hypersonische Waffen umfassen. Diese werden über deutlich größere Reichweite als die derzeitigen landgestützten Systeme in Europa verfügen. Die Beübung dieser fortgeschrittenen Fähigkeiten verdeutlichen die Verpflichtung der Vereinigten Staaten von Amerika zur NATO sowie ihren Beitrag zur integrierten europäischen Abschreckung“ (Gemeinsame Erklärung der Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland zur Stationierung weitreichender Waffensysteme in Deutschland)
Eine nicht viel ausführlichere Begründung lieferte Verteidigungsminister Boris Pistorius nahezu parallel dazu mit folgenden Worten ab: „Wir reden hier über eine durchaus ernst zu nehmende Fähigkeitslücke in Europa.„
Fast zehn Tage später schoben dann die die Parlamentarischen Staatssekretäre Siemtje Möller (Verteidigung) und Tobias Lindner (Auswärtiges Amt) in einem Schreiben an den Außen- und Verteidigungsausschuss des Bundestages eine etwas ausführlichere Begründung nach: „Russland hat in den vergangenen Jahren massiv im Bereich weitreichender Raketen und Marschflugkörper aufgerüstet. […] Wir beobachten, dass Art und Umfang der massiven russischen Aufrüstung auch über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hinaus zur Aufstellung und Stärkung von gegen den Westen gerichteten Fähigkeiten und Kapazitäten genutzt werden.“ (Siemtje Möller/Tobias Lindner, Spiegel Online, 19.7.2024)
Viel kam danach nicht mehr, im Wesentlichen ist es bei dieser knappen Argumentation geblieben, die viele Expert*innen aus guten Gründen für wenig überzeugend halten. Die wohl lauteste kritische Stimme ist Oberst a.D. Wolfgang Richter, der als früherer Abteilungsleiter beim Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr wissen dürfte, von was er da spricht. Zuerst in einer ausführlichen Studie für die Friedrich-Ebert-Stiftung und später in einem Buchbeitrag für den von Johannes Varwick herausgegebenen Sammelband „Die Debatte um US-Mittelstrecken in Deutschland“ kam er zu der Schlussfolgerung: „Die Behauptung einer so genannten Fähigkeitslücke als Begründung für eine Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen ist nicht nachvollziehbar.“ (Wolfgang Richter, Oberst a.D.)
Stationierungsbefürworter wie der Wissenschaftler Jonas Schneider und Bundeswehr-Oberst Torben Arnold begründen in einem Papier für die regierungsberatende „Stiftung Wissenschaft und Politik“ ihre Position folgendermaßen: „Moskau verfügt über den Marschflugkörper SSC-8 (Zahl im hohen zweistelligen Bereich), der den INF-Vertrag 2019 zu Fall brachte, seit 2023 über die Raketen Zolfaghar aus Iran (rund 400 Stück) und KN-23 aus Nordkorea (etwa 50 Stück). Die seegestützten Hyperschall-Marschflugkörper Zirkon (Zahl im hohen zweistelligen Bereich) verschießt Russland seit 2024 auch von Land aus. Von seiner ballistischen Iskander-Version SS-26 müsste Moskau trotz ihres Einsatzes gegen die Ukraine noch deutlich über 100 Stück haben (Fachleute betrachten die SS-26 als Mittelstreckenwaffe.) Die Bilanz: Russland besitzt weit über 500 bodengestützte Mittelstreckenflugkörper, die Nato in Europa bislang keinen einzigen.“ (Jonas Schneider/Torben Arnold, SWP-Aktuell, Nr. 36/2024)
Selbst wenn man diese – womöglich deutlich zu hoch gegriffene – Zahl für bare Münze nehmen sollte, wird allerdings noch lange kein Rüstungsschuh daraus. Wolfgang Richter und andere weisen darauf hin, dass Russland zwar tatsächlich über deutlich mehr landgestützte Kurz- und womöglich auch Mittelstreckenwaffen verfügt als die NATO, dies aber durch deren Überlegenheit bei see- und luftgestützten Waffensystemen mehr als wettgemacht werde. So etwa auch Ulrich Kühn vom Forschungsbereich „Rüstungskontrolle und Neue Technologien“ am „Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik“ Hamburg: „Es stimmt, dass Europa bisher nicht über bodengestützte Abstandswaffen in diesem Spektrum verfügt. Allerdings verfügen Nato-Staaten über luft- und seegestützte Mittelstreckenraketen, weshalb keine generelle Fähigkeitslücke besteht.“ (Ulrich Kühn, ISFH, Neues Deutschland, 30.8.2024)
Konkret spricht Wolfgang Richter in seinem Buchbeitrag davon, „mehr als 3.000 solcher Wirkmittel“ befänden sich in Europa im Bestand von NATO-Staaten (die gesamten westlichen Arsenale liegen noch einmal deutlich höher).
… oder Angriffswaffen
Von einer russischen Überlegenheit kann also keine Rede sein, eine Fähigkeitslücke existiert nicht, es sei denn, man will unbedingt die speziellen Eigenschaften landgestützter Waffensysteme nutzen. See- und luftgestützte Waffen brauchen länger um ihr Ziel zu erreichen, es bleibt Zeit für die Lagefeststellung und für einen etwaigen Gegenschlag, sie sind damit per se nur bedingt offensiv für Überraschungsangriffe auf strategische Ziele (Radaranlagen. Raketensilos, Kommandozentralen…) geeignet – ganz im Gegenteil zu den ultraschnellen und hochmobilen landgestützten Systemen, die nun in Deutschland stationiert werden sollen. Wie Wolfgang Richter in seinem Buchbeitrag kritisiert, lassen die Pläne kaum einen anderen Schluss zu: „Dafür gibt es jedoch nur ein operativ logisches Szenario: Die NATO schießt zuerst.“
Und genau in dieser Kritik erblicken Stationierungsbefürworter wie die bereits zitierten Jonas Schneider und Torben Arnold den „Wert“ dieser Waffen: „Marschflugkörper, die von Flugzeugen abgefeuert werden, müssen zuerst in die Luft gebracht werden, wodurch wertvolle Zeit verlorengeht. […] Verfügbare seegestützte Marschflugkörper haben entweder zu kurze Reichweiten oder sind wegen ihrer eher geringen Geschwindigkeit zu lange unterwegs für zeitkritische Ziele im russischen Kernland. […] Nicht nur die LRHW, auch die SM 6-Version der Army fliegen mit über fünffacher Schallgeschwindigkeit und sind im Zielanflug manövrierbar. Daher sind sie hocheffektiv gegen mobile Ziele und sehr schwer abzufangen, selbst für moderne Raketenabwehr. Die Dark Eagle ist mit bis zu 17-facher Schallgeschwindigkeit kaum zu stoppen. Mit dieser hohen Eindringfähigkeit sind beide Waffen ideal, um auch solche russischen Hochwertziele auszuschalten, die gezielt geschützt werden.“ (Jonas Schneider/Torben Arnold, SWP-Aktuell, Nr. 36/2024)
Noch deutlicher wurde ihre Kollegin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, Claudia Major, die in einem viel zitierten Beitrag bereits im Sommer 2024 folgende Sätze zum Besten gab: „Die Tomahawks sollen bis zu 2500 Kilometer weit fliegen können, könnten also Ziele in Russland treffen. Und ja, genau darum geht es. […] So hart es klingt. Im Ernstfall müssen NATO-Staaten auch selbst angreifen können, zum Beispiel, um russische Raketenfähigkeiten zu vernichten, bevor diese NATO-Gebiet angreifen können, und um russische Militärziele zu zerstören, wie Kommandozentralen.“ (Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik, Handelsblatt, 19.07.2024)
Risiken und Nebenwirkungen
Die katastrophalen Folgen der Stationierungspläne sind schon heute offensichtlich. All das wäre unmöglich gewesen, hätten die USA nicht im Februar 2019 unter zumindest zweifelhaften Anschuldigungen, den INF-Vertrag gekündigt, der u.a. Produktion, Besitz und Stationierung landgestützter Kurz- und Mittelstreckenaffen mit Reichweiten zwischen 500km und 5.500km verbot. Auch der anschließende russische Vorschlag für ein beiderseitiges Moratorium wurde abgelehnt und umgehend schon lange ausgearbeitete US-Pläne zur Entwicklung neuer Waffensysteme aus der Schublade geholt.
Dennoch hielt sich Russland aus seiner Sicht lange an das Moratorium: Im Prinzip hatte sich dieses Moratorium aber mit dem mit einer russischen Mittelstreckenrakete („Oreshnik“) am 21. November 2024 erfolgten Angriff auf Ziele in der Ukraine erledigt – auch wenn Russland die Angriffe zynisch noch als „Live-Test“ bezeichnete. Gleichzeitig wurde die umfassende Produktion und gegebenenfalls Stationierung dieser und anderer Mittelstreckenwaffen angekündigt, sollte der Westen nicht von seinen Plänen abrücken: „Wir entwickeln Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen als Antwort auf die Pläne der Vereinigten Staaten, Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zu produzieren und zu stationieren. […] Ich möchte Sie daran erinnern, dass Russland sich freiwillig und einseitig verpflichtet hat, keine Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen zu stationieren, solange amerikanische Waffen dieser Art in keiner Region der Welt auftauchen. […] Die Frage der weiteren Stationierung von Raketen mittlerer und kürzerer Reichweite wird von uns in Abhängigkeit von den Aktionen der Vereinigten Staaten und ihrer Satelliten entschieden werden.“ (Wladimir Putin, 21.11.2024)
Vor wenigen Tagen wurde das Moratorium dann durch den russischen Außenminister Sergej Lawrow auch offiziell faktisch aufgekündigt: „Heute ist klar, dass zum Beispiel unser Moratorium für die Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen praktisch nicht mehr umsetzbar ist und aufgegeben werden muss. Die USA haben die Warnungen Russlands und Chinas arrogant ignoriert und sind in der Praxis dazu übergegangen, Waffen dieser Klasse in verschiedenen Regionen der Welt zu stationieren.“ (Sergej Lawrow, Die Welt, 30.12.2024)
So gefährlich diese Entwicklung ist, überraschen kann sie nicht und Experten wie Wolfgang Richter haben schon unmittelbar nach der deutsch-amerikanischen Ankündigung ihrer Stationierungsabsichten genau davor gewarnt: „Im Unterschied zum Doppelbeschluss von 1979 enthält die bilaterale Stationierungsentscheidung keinen Ansatz für eine rüstungskontrollpolitische Einhegung der Eskalationsgefahren und des nun wahrscheinlichen Stationierungswettlaufs mit Russland. Das russische Angebot eines Moratoriums für die Stationierung von landgestützten Langstreckenwaffen im INF-Spektrum dürfte sich damit erledigt haben, zumal Moskau bereits Gegenmaßnahmen angekündigt hat.“ (Wolfgang Richer)
Genauso wurde früh davor gewarnt, Russland werde sich gezwungen sehen, etwaige Pläne zur Stationierung landgestützter Mittelstreckenwaffen mit einer Absenkung seiner nuklearen Einsatzschwelle zu kontern – und auch dies ist mit der neuen russischen Nukleardoktrin geschehen, die am 19. November 2024 in Kraft gesetzt wurde: „Diese Veränderung läuft auf eine erhebliche Absenkung der Schwelle für einen atomaren Ersteinsatz in einem bis dahin konventionellen Krieg und damit auf eine Erhöhung des Risikos einer unkontrollierbaren atomaren Eskalation hinaus.“ (Rainer Böhme und Wolfgang Schwarz, Das Blättchen, 2.12.2024)
Im Februar 2026 läuft außerdem der letzte große russisch-amerikanische Rüstungskontrollvertrag („New Start“) aus. Er verpflichtet beide Seiten Obergrenzen der strategischen Waffen mit interkontinentaler Reichweite einzuhalten, sowohl was die nuklearen Sprengköpfe (1.550) als auch die Trägersysteme (800) anbelangt. Bleibt es bei der Stationierungsentscheidung dürften die ohnehin geringen Aussichten auf eine Verlängerung gegen null sinken. Die Kontrahenten haben aktuell zusätzlich noch tausende Sprengköpfe eingelagert, die binnen Monaten montiert werden könnten. Auch mit der Produktion neuer Sprengköpfe wäre zu rechnen – und ebenso damit, dass dann andere Atomwaffenstaaten ihre Arsenale ebenfalls noch weiter ausbauen würden.
Kampagne formiert sich
Allein diese unvollständige Aufzählung einiger der katastrophalen Auswirkungen der Stationierungspläne sollte als Motivation ausreichen, sich gegen diese Waffensysteme zu engagieren.
Am 3. Oktober 2024 wurde hierfür der Berliner Appell „Gegen neue Mittelstreckenwaffen und für eine friedliche Welt“ bei der Friedensdemonstration in Berlin gestartet. Er wurde bislang von über 26.500 Menschen unterzeichnet, was hier möglich ist. Im November 2024 wurde darüber hinaus die Kampagne „Friedensfähig statt erstschlagfähig!“ ins Leben gerufen, der sich mittlerweile über 40 zivilgesellschaftlichen Gruppen angeschlossen haben: „Ziel der Kampagne ‚Friedensfähig statt erstschlagfähig: Für ein Europa ohne Mittelstreckenwaffen!‘ ist es, möglichst breite und bundesweite Proteste gegen die geplante Stationierung landgestützter US-Marschflugkörper, Hyperschallwaffen und Raketen in Deutschland zu bündeln. Wir wollen über die Risiken und Gefahren der Stationierung aufklären und so die dringend nötige Debatte lostreten, vor der sich der Bundeskanzler seit der Ankündigung der Stationierung im Juli 2024 drückt.“
Damit dies gelingt und die Kampagne Fahrt aufnimmt, werden auch weitere Gruppen gesucht, die sich ihr anschließen. Eine Mehrheit der Bevölkerung spricht sich jetzt schon gegen die Stationierungspläne aus, es besteht also durchaus die Aussicht, zahlreiche Menschen hinter den Forderungen zu versammeln, die sich auf der Internetseite der Kampagne „Friedensfähig statt erstschlagfähig!“ finden lassen:
— Stopp der geplanten Stationierung neuer US-Mittelstreckensysteme in Deutschland
— Abbruch der Projekte zur Entwicklung eigener europäischer Hyperschallwaffen und Marschflugkörper, an denen Deutschland sich beteiligen will
— Neue Initiativen für gemeinsame Sicherheit und Zusammenarbeit und die langfristige Vision einer neuen Friedensordnung in Europa
— Dialog statt Aufrüstung: Wiederaufnahme von Verhandlungen über Rüstungskontrolle und (nukleare) Abrüstung (z.B. für ein multilaterales Folgeabkommen zum INF-Vertrag)
Vorabdruck. Kabinett des Grauens. Am 20. Januar tritt Donald Trump seine zweite Amtszeit als Präsident an. Ein Überblick über die neue US-Regierung
In der kommenden Woche erscheint im Hamburger VSA-Verlag die Flugschrift »Trumps Triumph?«. Ingar Solty behandelt darin die Frage der kommenden Politik im Weißen Haus. Wir drucken mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag vorab einen redigierten Auszug. (jW)
Nach dem Wahlsieg fiel vor allem eins auf: wieviel besser das Trump-Lager diesmal vorbereitet war. Man vollzog die Verkündung der Personalentscheidungen mit einiger Cleverness. Trump hatte nicht bloß die Stimmen der multiethnischen Arbeiterklasse zu signifikanten Teilen gewonnen, sondern auch gelernt, die abgestandene Sprache der (links-)liberalen Identitätspolitik gegen seinen am Boden liegenden Gegner zu wenden. Genüsslich imitierte er bei der Ernennung von Susie Wiles die Rhetorik der »firsts« – »first black president«, »first woman«, »first openly gay«. Die 67 Jahre alte Managerin der Kampagne, zudem Lobbyistin für zuletzt 42 Konzerne, wird als Stabschefin im Weißen Haus tätig sein: »Susie« werde die »erste Frau in der Geschichte der Vereinigten Staaten, die das Amt bekleiden wird«. Eine Kooptation der Sprache seines Gegners, die das ganze Elend des progressiven Neoliberalismus bloßlegt, der den Fortschritt nicht anhand materieller Verbesserungen misst, sondern anhand symbolischer Repräsentation.
Entsprechend schwer tat sich die linksliberale Blase auch damit, dass Trumps designierter Finanzminister Scott Bessent nicht nur ein marktradikaler Milliardär, sondern der erste offen homosexuelle Mann in diesem Amt sein wird. Bessent sei »seine Community offenbar egal«, echauffierte sich das Portal LGBTQNation über dessen Bereitschaft, »für die LGBTQ+-feindlichste Regierung aller Zeiten zu arbeiten«. Der Gedanke, dass Bessent womöglich einer anderen, sehr viel entscheidenderen Community angehört, nämlich der Gemeinschaft der Milliardäre, lag offensichtlich fern. Was die betrifft, wird er in guter Gesellschaft sein. Mindestens 13 Milliardäre rücken am 20. Januar in höchste Regierungsämter.
Loyalität oder Ideologie?
Einer der Strippenzieher bei der Kabinettsbildung war Howard Lutnick, ein Milliardär und alter Freund Trumps. Mit Blick auf die erste Trump-Regierung sprach Lutnick von »Anfängerfehlern«, die es nun zu vermeiden gelte. In den Medien wurde viel über die Personalie Robert F. Kennedy Jr. gesprochen, der als Coronaskeptiker neuer Gesundheitsminister werden soll. Die Aufregung verdeckte eine wichtigere Frage: die nach dem Motiv der Akquise. War uneingeschränkte Loyalität zu Trump das entscheidende Kriterium oder ideologische Reinheit? Tatsächlich hat Trump viele Gefolgsleute um sich geschart, die sich als treue Weggefährten erwiesen haben. Zu ihnen gehören die designierten Chefs Lee Zeldin (Umweltschutzbehörde), Russell Vought (Bundeshaushaltsbehörde), John Ratcliffe (CIA) und Brooke Rollins (Landwirtschaftsministerium) sowie die designierte Generalstaatsanwältin Pam Bondi und Elise Stefanik, designierte UN-Botschafterin der USA.
Bondi stammt aus der Tea-Party-Bewegung und ist regelmäßig bei Fox News zu Gast. Als Generalstaatsanwältin in Florida stellte sie ein Betrugsverfahren gegen Trump ein, den sie später als Anwältin vertrat. Zeldin wiederum hat Trump schon während des ersten Amtsenthebungsverfahrens vom Dezember 2019 vertreten. Als republikanischer Abgeordneter hatte er sich vor allem für die Verschärfung des Abtreibungsrechts sowie für eine proisraelische Politik eingesetzt, jetzt soll er die Umweltschutzbehörde übernehmen, und das heißt: sie systematisch schrumpfen und entmachten.
Die entscheidende Personalie unter den Trump-Loyalen ist Vought. Der antikommunistische Kulturkrieger erwarb sich in der ersten Trump-Regierung als Chef des »Office of Management and Budget« Loyalitätspunkte, indem er der von Trump nicht anerkannten Biden-Regierung den Zugang zur ständigen Verwaltung versperrte. Jetzt soll er auf seinen Posten zurückkehren. Dort dürfte der nach eigener Aussage »christliche Nationalist« den Kulturkampf in den Bundeshaushalt tragen. Im Februar 2018 sprach er im Senat davon, dass »Muslime nicht bloß theologisch defizitär«, sondern als »Ungläubige«, die Jesus nicht als Sohn Gottes anerkennen würden, auch »verdammt« seien. Nach seinem Ausscheiden gründete er das »Center for Renewing America«, das sich dem Kampf gegen die »Critical Race Theory« verschrieben hat, und war eine zentrale Figur beim »Project 2025«.
Wall Street vs. Industrie
Für die Hegemoniefähigkeit des Trump-Projekts ist die wirtschaftspolitische Ausrichtung entscheidend. Seit der neoliberalen Wende wird darüber im Finanzministerium entschieden, bei Scott Bessent also. Die ersten Schritte zu seinem Milliardenvermögen machte er als Mitarbeiter von George Soros. So war Bessent an der berüchtigten Spekulation beteiligt, die auf einen herbeigeführten Kursverfall des britischen Pfunds wettete. Der Gewinn betrug eine Milliarde US-Dollar. Bessent war auch mit an Bord, als das Finanzunternehmen eine ähnliche Operation gegen den japanischen Yen unternahm. Seine Anteile an der Beute nutzte er für die Gründung eines eigenen Hedgefonds, der »Key Square Group«, die nicht nur engen Kontakt zu Soros hielt, sondern wie dieser auf die Demokraten setzte. So trat Bessent als finanzieller Unterstützer von Al Gore, Hilary Clinton und Barack Obama in Erscheinung, ehe er 2016 die Trump-Kampagne mit Beträgen im hohen zweistelligen Millionenbereich finanzierte.
Als Repräsentant des Finanzkapitals sorgt sich Bessent vor allem um die Profite der Wall Street. Mit seiner Person könnte, wie schon 2016, die Perspektive einer dauerhaften Einhegung Trumps durch das globale Finanzkapital verbunden sein. Seine wirtschaftspolitische Ausrichtung ist entsprechend eher neoliberal und marktradikal: Senkung von Steuern für Konzerne und Superreiche durch Haushaltsdisziplin (soziale Kürzungsmaßnahmen und Austerität), expansive Geldpolitik und Offenheit für Industriesubventionen vor dem Hintergrund der Konkurrenz mit China. Handelspolitisch hingegen warnt Bessent im Interesse des Finanzkapitals, das auf global uneingeschränkte Mobilität angewiesen ist, vor dauerhaftem Protektionismus durch Außenhandelszölle, da sie die Börsenkurse beeinträchtigen könnten. Auf die nach seinem Wahlsieg in die Höhe geschossenen Kurse ist auch Trump stolz, weil sie für ihn persönliche Bereicherung bedeuten und die Vermögensanhäufung des oberen einen Prozents ihm als Messlatte seines politischen Erfolgs gilt.
Zugleich aber hat Trump im Wahlkampf die Einführung eines 20-Prozent-Grundzolls gegen alle Staaten der Welt und einen Zoll von 60 Prozent auf alle Warenimporte aus China versprochen. Aus Sorge um das Finanzkapital, dem er angehört, hat Bessent beschwichtigt, die 20-Prozent-Grundzollforderung sei lediglich ein »negotiating ploy«, um mit der Androhung von Handelsbeschränkungen verbesserte Handelsbindungen, Extraprofite durch verstärkte Patentregelungen und höhere Rüstungsausgaben seitens der NATO-Verbündeten zu erzwingen.
Auch diesmal hat Trump im Wahlkampf argumentiert, dass Importbeschränkung ein Machthebel sei. Zollpolitik als Waffe passt auch in sein Verständnis von Verhandlungen und seine Präferenz für bilaterale Deals. Zugleich hat er versprochen, dass die Zollerhöhungen die Senkung der Unternehmenssteuer und des Spitzensteuersatzes gegenfinanzieren sollen (statt wie nach 2017 die Staatsschulden und das Haushaltsdefizit dramatisch zu erhöhen). Womöglich zeichnet sich hier also ein Richtungsstreit ab, der dann auch einer mit Lutnick sein wird, der das Amt des Handelsministers ausüben wird. Im Gegensatz zu Bessent sieht Lutnick in Schutzzöllen die Grundlage für allgemeinen Wohlstand. Auch er ist Milliardär. Mit Trump verbindet ihn eine lange New Yorker Businessgeschichte.
Lutnicks Kapitalfonds »Cantor Fitzgerald« setzt auf Investment in Immobilien und den Handel mit US-Staatsanleihen, wofür er die Lizenz vom Staat hat. Auch vor diesem Hintergrund erklärt sich, dass der künftige Handelsminister eher die Interessen des binnenorientierten Industriekapitals vertritt, das vor seiner mangelnden Wettbewerbsfähigkeit am Weltmarkt geschützt werden soll. Die Schutzzollpolitik ist von Trump und Lutnick immer wieder im Namen der Arbeiterklasse bemüht worden, als Mittel zum Erhalt von Arbeitsplätzen. Der rechte Protektionismus hat einen wahren Kern, der ihn überhaupt erst plausibel macht, weil er im Gegensatz zum alten Neoliberalismus das Primat der Politik über die Wirtschaft zurückfordert. Zugleich ist dieser Wirtschaftsnationalismus eine gefährliche Illusion, weil Reindustrialisierung und das Anlocken von Auslandskapital mittels der Kombination von hohen Außenhandelszöllen und »Local Content«-Lieferkettenregelungen, verbunden mit neoliberalen Steuersenkungen und der Eliminierung von Umwelt- und Arbeitsschutzmaßnahmen, nie zum Gemeinwohl führen können. Eine solche Politik wird das »verlorene Paradies« der 1950er und 1960er Jahre, das die »Make America Great Again«-Ideologie nostalgisch herbeiruft, nicht wiederherstellen.
Trotzdem wirkt das Schutzzollversprechen als süßes Gift. Der Lebensstandard der US-Arbeiterklasse ist abhängig von Importen günstiger Konsumgüter aus den Entwicklungsländern. Die Entmachtung der Gewerkschaften im Westen und die daraus folgenden sinkenden Lohnquoten wurden ab den 1980er Jahren faktisch nur durch diese Form der Globalisierung des Kapitalismus kompensiert. Schutzzölle treffen nun aber eine ökonomisch verwundbare Arbeiterklasse, die sich die Teuerung der Importgüter nicht leisten kann. Sollte sich also der starke Lutnick-Flügel in der Trump-Administration durchsetzen, wird die Arbeiterklasse, die Trump zu großen Teilen gewählt hat, die Steuersenkungen bezahlen. Für eine nachhaltige Bindung der Klasse an Trump und die Republikanische Partei spricht das nicht.
Im Juni 2024 warnten 16 Wirtschaftsnobelpreisträger – darunter Joseph Stiglitz und Edmund S. Phelps – in einem offenen Brief, dass Trumps Schutzzollpolitik die Inflation »wieder anheizen« werde. Trotz Differenzen seien sie überzeugt, dass Bidens »Wirtschaftsagenda« mit ihrem Fokus auf »Infrastrukturinvestitionen, nationale Industrieproduktion und Klimaschutz« der Agenda »von Donald Trump weit überlegen« sei. Eine Studie der Volkswirte Kimberly Clausing und Mary Lovely bezifferte die zu erwartenden Einkommensverluste pro Privathaushalt auf 2.600 US-Dollar im Jahr, sollte es zur Einführung von 60-Prozent-Schutzzöllen auf alle Waren aus China und von 20-Prozent-Außenhandelszöllen auf Waren aller anderen Länder kommen. Das Peterson Institute for International Economics stellte für 2026 eine Inflationsrate von 6 bis 9,3 Prozent in Aussicht statt 1,9 Prozent, sollte Trump neben seiner Schutzzollpolitik auch die angekündigten Massendeportationen von mehr als zwölf Millionen Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung durchführen. Das würde zu einem erheblichen Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft führen.
China im Visier
Ein möglicher Kompromiss zwischen dem Bessent- und Lutnick-Flügel zeichnet sich ab, insofern Bessent zwar kritisch gegenüber dem dauerhaften Grundzoll von 20 Prozent ist, aber den Handelskrieg gegen China durchaus führen will. In einem Interview mit Bloomberg News vom August 2024 verknüpfte er seine Beteuerung, dass Zölle nur »einmalige Preisanpassungen« seien, mit der Aussage, dass sie ausschließlich gegen China gerichtet sein werden. Denkbar, dass er damit der Stärke des wirtschaftsnationalistischen Flügels Rechnung trägt. Lutnick weiß vor allem den Schattenpräsidenten Elon Musk auf seiner Seite, der als 486 Milliarden US-Dollar reicher Marktradikaler den Bundeshaushalt drastisch zusammenkürzen will und von Trump auch mit entsprechenden Kompetenzen versehen worden ist. Musk stellte sich nach den Wahlen auf Lutnicks Seite: In einem Tweet schrieb er, dass Bessent eine »Weiter-so-Wahl« sei.
Weitere Verbündete von Lutnick sind Jamieson Greer, der den Präsidenten in Handelsfragen berät, und Trumps oberster persönlicher Berater Peter Navarro. Der emeritierte Ökonom Navarro hat in Trumps erster Regierung zunächst den »Nationalen Handelsrat« des Weißen Hauses geleitet und anschließend das »Office of Trade and Manufacturing Policy«, das die wirtschaftsnationalistischen Kräfte in der Regierung als besondere Bastion neu geschaffen hatten. Greer wiederum war in der ersten Trump-Regierung als Stabschef des damaligen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer für die Schutzzollpolitik gegen China und die Neuverhandlung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) zuständig.
Die Wirtschaftspolitik der USA ist darauf geeicht, den Wirtschaftskrieg gegen China noch einmal zu intensivieren. Womit die USA ihren relativen Abstieg als Hegemonialmacht aufzuhalten und die Verschiebung des weltwirtschaftlichen Schwerpunkts in den globalen Süden zu blockieren suchen. In diesem Ziel haben Demokraten und Republikaner Konsens. Wie auch im Ziel einer Reindustrialisierung, das schon von Obama ausgegeben wurde. Während die Biden-Regierung aber eine Mischung aus Schutzzöllen, Konkurrenz bei der Elektrorevolution und außenpolitische Einkreisungspolitik favorisierte, sehen die Trump-Republikaner den Kampf um die E-Revolution offenbar als verloren an und setzen eher auf das alte fossile Kapital und neoliberale Steuerpolitik zur Stärkung der Verbrenner produzierenden Autokonzerne.
Diese Orientierung teilt auch die neue Regierung. Energieminister wird Chris Wright, CEO von Liberty Energy, dem mit einem Marktwert von 3,2 Milliarden Euro zweitgrößten Frackinggas-Konzern Nordamerikas. Wrights persönliches Jahreseinkommen 2023 betrug 5,6 Millionen US-Dollar. Für Trump spendete er 228.390 Dollar. Wright leugnet, dass es eine Klimakrise gibt und betont, dass »wir uns nicht in der Mitte einer Energiewende befinden«. Sein erklärtes Ziel ist, die Maßnahmen der Biden-Regierung – einschließlich der Beschränkungen für CO2-Emissionen – rückgängig zu machen. Unter Wright und Trump werden die USA voraussichtlich auch wieder aus dem Pariser Klimaabkommen austreten.
Entscheidend wird sein, wie stark Trumps Bruch mit Bidens allgemeiner Konjunktur- und Infrastrukturpolitik ausfällt. Im Wahlkampf stellte er sich gegen deren tragende Säulen. Aber auch 2016 hatte er sich im Wahlkampf zunächst gegen Obamas Gesundheitsreform ausgesprochen, um »Obamacare« in seiner Amtszeit dann doch fortzuführen. Gegen die Fortsetzung der fiskalisch expansiven Wirtschaftspolitik wird Trump wohl von Stephen Miran beraten werden, dem designierten Chef des »Council of Economic Adviser«. Miran, »Senior Strategist« des großen Kapitalanlegers »Hudson Bay Capital Management«, arbeitete bereits von 2020 bis 2021 für die Trump-Regierung und den damaligen Finanzminister Steven Mnuchin. Er war in dieser Zeit ein Kritiker der Konjunkturpolitik der US-Notenbank in Reaktion auf die durch die Coronapandemie verschärfte Rezession.
Konfrontation statt Isolationismus
Die Zeichen stehen auf Konfrontation. Darauf deuten nicht nur die Personalentscheidungen in der Wirtschafts- und Finanzpolitik hin, sondern auch die in der Außenpolitik. Hierfür steht zunächst einmal der designierte Außenminister Marco Rubio. Wirtschaftspolitisch fügt sich der frühere Präsidentschaftskandidat nahtlos in die marktradikale Ausrichtung ein. Lange trat er als Freihändler in Erscheinung und engagierte sich für – das Kapitalprofite gegen demokratische Entscheidungen absichernde – Investitionsschutzabkommen »Trans Pacific Partnership«. Dann aber zeigte er sich als Unterstützer des Wirtschaftskriegs gegen China. 2017 setzte er sich dafür ein, dass der US-Staat chinesische Beteiligungen an US-Hightechfirmen im Namen der nationalen Sicherheit verbieten darf. Wenig später war er Mitinitiator eines parteiübergreifenden Briefs an das Heimatschutzministerium, das die zuständigen Minister zu einer Verschärfung der Sanktionspolitik gegen Huawei aufforderte. Außerdem legte Rubio eine Gesetzesinitiative vor, die Trumps Exekutivanordnung kodifizieren sollte, damit Huawei und andere chinesische Konzerne als eine Gefahr für die nationale Sicherheit vom amerikanischen Markt ausgeschlossen werden konnten. Im November 2018 warnte er in einem offenen Brief an Trump vor einer vermeintlichen Infiltration der Medien und Hochschulen durch Chinesen, um dann, wenige Wochen später, auch auf schärfere Maßnahmen zur Sanktionierung von europäischen und anderen internationalen Konzernen zu drängen, die Handel mit China treiben. Zudem forderte er im Februar 2019 weitere Gesetze, die chinesische Investitionen in den USA einschränkten und mit Sondersteuern belegten. Dem Finanzkapital warf er im Mai 2021 vor, »das kommunistische China zu unterstützen« und schwadronierte über eine ominöse »Linkswende unserer Konzerne und des Finanzsektors«. Im März 2023 forderte Rubio, dass zum Schutz der US-Industrie China der Status als normaler Handelspartner entzogen werde.
Keine Koexistenz mit »Barbaren«
Der Wirtschaftskrieg wird auch bei Rubio mit einer Politik der militärischen Einkreisung verknüpft, Regime-Change-Strategien eingeschlossen. Während der Hong-Kong-Proteste von 2014 und von 2019/2020 gab er dem unverhohlen Ausdruck. 2017 drängte er zusammen mit 16 weiteren Kongressabgeordneten auf die Verabschiedung des »Global Magnitsky Act«, nach dem chinesische Staatsbürger wegen Chinas Uigurenpolitik in Xinjiang sanktioniert werden können. Im Januar 2021 hatte Rubio Erfolg, als die von ihm vorgelegte Gesetzesvorlage »Uyghur Forced Labor Prevention Act« vom Kongress angenommen wurde, obwohl sich die Lage in der Provinz in den letzten Jahren entschärft hatte, Terroranschläge zurückgegangen, Straßenblockaden aufgehoben und »Internierungslager« aufgelöst worden waren. Nicht erfolgreich war Rubio ein Jahr später mit einer Gesetzesvorlage, die den mehr als 100 Millionen Mitgliedern der chinesischen Kommunistischen Partei verbieten sollte, in die USA einzureisen. Die ebenfalls 2022 in China ausgetragenen Olympischen Winterspiele verurteilte Rubio und bezeichnete die Volksrepublik als ein »genozidales Regime des Bösen«.
Die militärische Flanke der neuen Blockkonfrontation führt dabei über den Weg der Aufweichung der Ein-China-Politik. Die Biden-Regierung hat hier bereits wesentliche Schritte unternommen. Dazu gehörten erstens die Reise Nancy Pelosis nach Taipeh im August 2022, zweitens die mehrfache Betonung des Präsidenten, man werde Taiwan gegen eine chinesische Invasion nicht nur mit Waffen und Geld, sondern auch eigenen Truppen verteidigen, und drittens die im November 2023 beschlossene direkte Finanzierung der US-Aufrüstung Taiwans durch den US-Steuerzahler. Rubio geht noch weiter und plädiert offen für die Unabhängigkeit Taiwans. Insofern nun die Volksrepublik mit dem Status quo gut leben kann, weil Festlandchina und Taiwan wirtschaftlich eng verflochten sind und die Guomindang heute die wirtschaftliche Verflechtung der Insel mit der Volksrepublik befördern, die chinesische Regierung aber ein mit US-Waffen, womöglich atomaren Mittelstreckenraketen, aufgerüstetes Taiwan nicht akzeptieren kann, stehen die Zeichen in dieser Frage auf Sturm.
Auch andere Weltregionen betreffend gilt Rubio als Falke. Etwa beim Embargo gegen Kuba oder in Bezug darauf, ob es in der Ukraine zu einem Einfrieren des Konflikts kommt. Der USA-China-Konflikt, der Bedeutungsverlust des Westens und der Aufstieg des globalen Südens haben das Potential für rasch eskalierende Stellvertreterkriege in vielen Weltregionen. Das gilt auch für den Nahen Osten. Die Nominierung von proisraelischen Hardlinern wie der UN-Botschafterin der USA, Elise Stefanik, oder dem Sondergesandten für den Nahen Osten, Steve Witkoff, sendet entsprechende Signale. Auch der künftige Außenminister ist für seine besonders harte Haltung gegen die Palästinenser bekannt. Zu letzterer gehören die Ablehnung der Zweistaatenlösung – Rubio bezeichnet sie als »eine Anti-Israel-Position« –, seine Zustimmung zur Anerkennung Jerusalems als Israels neuer Hauptstadt und die Unterstützung der rechtsextremen israelischen Regierung bei ihrer Kriegspolitik nach den terroristischen Anschlägen der Hamas vom 7. Oktober 2022. Angesprochen auf die israelischen Kriegsverbrechen und die hohe Zahl an Ziviltoten im Ergebnis der KI-gestützten Kriegführung sagte Rubio gegenüber CNN: »Ich glaube nicht, dass irgend jemand von Israel erwarten kann, mit diesen Barbaren (im Original: savages, jW) zu koexistieren oder irgendeinen diplomatischen Kompromiss zu finden (…). Sie müssen ausgerottet werden.«
Rubios Außenpolitik wird komplettiert durch den prominenten Fox-News-Kommentator und designierten Verteidigungsminister Peter Hegseth. Vor seiner Tätigkeit als Talkshowmoderator bei Trumps Lieblingssender war Hegseth Teil des Wachpersonals im berüchtigten US-Foltergefängnis Guantánamo. Als Fox-News-Kommentator und Trump-Unterstützer war er es, der Trump 2019 zur Begnadigung von angeklagten und verurteilten US-Kriegsverbrechern ermutigte, darunter Eddie Gallagher, der für die versuchte Tötung von Zivilisten sowie die Ermordung eines minderjährigen Kriegsgefangenen unter Anklage stand. In seinem Buch »American Crusade. Our Fight to Stay Free« sprach sich Hegseth, der über enge Kontakte zu neonazistischen Gruppen verfügt, für einen »heiligen Krieg in der gerechten Sache der Freiheit« aus, wobei sein Verständnis von Freiheit die Abschaffung der »linken« Demokratie impliziert, da er davon ausgeht, dass der Gegensatz von links und rechts – Demokraten sieht Hegseth als »Feinde« der Freiheit an – sich nicht im politischen Prozess lösen lasse. Konkret prophezeite Hegseth für den Fall einer Wahlniederlage Trumps eine »nationale Scheidung« und plädierte für einen Militärputsch zugunsten Trumps: Polizei und Militär würden »in einer Form von Bürgerkrieg« gezwungen sein, »sich zu entscheiden«. Sein Buch sei in diesem Sinne auch als Grundlegung »der Strategie« gedacht, »die angewandt werden muss, um Amerikas innere Feinde zu besiegen«.
Im Amt will Hegseth nun nicht nur den »Wokeism im Militär« bekämpfen. Die Öffnung des Militärs für Homosexuelle betrachtete er lange als Teil einer »marxistischen« Agenda, heute wendet er sich nur noch gegen Transpersonen. Zugleich vertritt er die Position, dass »der Zionismus und Amerikanismus die Frontlinie der westlichen Zivilisation und Freiheit in der Welt« seien. Hegseth vertritt die rechtsextreme Great-Replacement-Theorie, nach der der Islam plane, Europa und Amerika zu erobern – im Bündnis mit dem Säkularismus. In Hegseth hat die Netanjahu-Regierung daher einen engen Verbündeten bei ihren Plänen, den Iran anzugreifen. »Das kommunistische China« wiederum, sagte Hegseth im Mai 2020, wolle »unsere Zivilisation beenden« und schaffe sich ein Militär, das »die Vereinigten Staaten von Amerika besiegen will«.
Deportation und Säuberungen
In der Innenpolitik, zu der wesentlich die geplanten Deportationen und die politischen Säuberungen gehören, gibt es ebenfalls Personalien, die es in sich haben. Trumps Beauftragter für Grenzschutz wird erneut der ehemalige Polizist Tom Homan. Homan ist ein Verfechter der Deportationspolitik und hat den »sanctuary cities« den Kampf angesagt. Als »Grenzzar« schon während der Obama- und dann in der ersten Trump-Administration war er Verfechter einer Politik, die Kinder an der Grenze von ihren Eltern trennte und sie separat in Abschiebegefängnissen internierte, um damit potentielle Einwanderer abzuschrecken. Nach Ende der ersten Trump-Regierung wurde er Fox-News-Kommentator und hat wesentlich am »Project 2025« und den darin enthaltenen Massendeportationsplänen mitgearbeitet.
Ingar Solty: Trumps Triumph? Gespaltene Staaten von Amerika, mehr Nationalismus, weitere und neue Handelskriege, aggressive Geopolitik. Eine Flugschrift, Hamburg: VSA-Verlag 2025, 120 S., 12 Euro
Seite 2 von 17