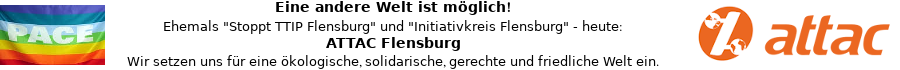13. Mai 2024
Die Steuersätze typischer Multimillionärinnen und Milliardäre liegen in Deutschland und Österreich weit unter den vorgesehenen Höchststeuersätzen. Ausgerechnet die als Steuersumpf bekannte Schweiz zeigt: Eine Vermögenssteuer kann gegenlenken.
von Julia Jirmann - https://www.jacobin.de/artikel/steuersystem-vermoegenssteuer-superreiche-iwf
Bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington unterstützten der französische Finanzminister und die Chefin des IWF einen koordinierten Vorstoß für eine höhere Besteuerung von Superreichen. Bereits beim Treffen der G20-Finanzminister im Februar dieses Jahres setzte der brasilianische Finanzminister die Vermögensteuer zum ersten Mal auf die Agenda. Zur Debatte stand eine globale Mindeststeuer von 2 Prozent auf die Vermögen der reichsten Menschen weltweit. Zudem forderte auch Joe Biden in seiner Rede zur Lage der Nation im März eine Mindeststeuer von 25 Prozent auf die Einkommen von Milliardärinnen und Milliardären.
Christian Lindner äußerte sich am Rande der IWF-Tagung erwartungsgemäß ablehnend. Es gebe bereits eine angemessene Besteuerung von Einkommen. Das stimmt offenkundig nicht, wie aktuell Untersuchungen des Netzwerks Steuergerechtigkeit, des Momentum Instituts und der KOF/ETH Zürich zu den tatsächlichen Steuersätzen von Superreichen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigt.
Das Versagen der Steuersysteme
Eigentlich ist das Steuersystem für demokratische Gesellschaften ein zentrales Instrument, um sozialen Ausgleich zu schaffen und Veränderungsprozesse, die im Interesse der Allgemeinheit liegen – wie etwa die ökologische Transformation – zu finanzieren und zu lenken.
In den meisten Demokratien sollen Steuersysteme mit progressiv ansteigenden Steuersätzen diese Aufgaben erfüllen. Menschen mit hohen Einkommen tragen demnach nicht nur einen höheren absoluten Betrag, sondern auch einen höheren relativen Anteil ihres Einkommens zur Gemeinschaftskasse bei. Allerdings haben in den vergangenen Jahrzehnten reichenfreundliche Reformen dafür gesorgt, dass die Steuersysteme gerade bei den höchsten Einkommen versagen und eine progressive Besteuerung entsprechend der Leistungsfähigkeit nicht mehr gewährleisten.
Bereits im vergangenen Jahr konnten Forschende für die USA, Frankreich und die Niederlande in Zusammenarbeit mit ihren nationalen Steuerbehörden nachweisen, dass die Steuerquoten bei den Superreichen wieder abnehmen. Unternehmenssteuern sind praktisch die einzige Steuerart, die sie entrichten. Und weil Steuerwettbewerb und künstliche Gewinnverschiebung dafür gesorgt haben, dass sowohl nominale als auch effektive Steuersätze für Unternehmen weltweit seit vielen Jahren sinken, werden Multimillionen- und Milliardeneinkommen nur noch mit 20 bis 30 Prozent besteuert.
»Das progressive Steuersystem ist darauf ausgerichtet, die breite Masse der arbeitenden Bevölkerung zu besteuern.«
Auch die reichsten Deutschen und Österreicher zahlen zu wenig in die Staatskasse. In der Schweiz trägt immerhin eine Vermögensteuer dazu bei, dass Superreiche mehr als die Steuer zahlen, die ihre Unternehmen entrichten, wie die neue Studie zeigt.
Berechnet wurden die Steuern und Sozialabgaben, die das reichste Prozent sowie Durchschnittsverdienende tatsächlich zahlen, und in welchem Verhältnis diese tatsächlichen Zahlungen zu den jeweiligen Höchststeuersätzen stehen. In Deutschland liegt der Höchststeuersatz bei 47,5 Prozent (Reichensteuersatz inklusive Solidaritätszuschlag) und in Österreich bei 55 Prozent. In der Schweiz hängt der Satz stark vom Wohnort ab und schwankt zwischen 22 Prozent in Zug und 45 Prozent in Genf.
Weil Steuerdaten zu hohen Vermögen lückenhaft sind, arbeitet die Studie mit exemplarischen Modellrechnungen für die Anteilseignerinnen und -eigner der größten Familienunternehmen des jeweiligen Landes. In Deutschland sind das die BMW-Erben Susanne Klatten und Stefan Quandt, in Österreich der Red Bull-Erbe Mark Mateschitz und in der Schweiz die Roche-Erben Jörg Duschmalé und André Hoffmann. Ihr Einkommen, ihre Steuerzahlungen und damit auch ihre effektiven Steuersätze (Anteil der Steuern am Einkommen) lassen sich näherungsweise aus den öffentlich zugänglichen Geschäftsberichten ihrer Unternehmen und den Beteiligungsstrukturen berechnen.
Während die Roche-Erben mit einem Steuersatz von rund 32 Prozent immerhin etwas mehr als drei Viertel des geltenden Höchststeuersatzes ihres Kantons (40,5 beziehungsweise 41,5 Prozent) abgeben, liegen die Steuersätze der Menschen mit Milliardenvermögen in Deutschland und Österreich bei lediglich 26 Prozent beziehungsweise 25 Prozent und damit weit unter den jeweiligen nationalen Höchststeuersätzen (47,5 beziehungsweise 55 Prozent). Auch die typischen Multimillionäre bleiben in Deutschland und Österreich deutlich unter den Höchststeuersätzen: Ihre Steuer- und Abgabensätze liegen bei rund 29 Prozent in Deutschland und 30 Prozent in Österreich.
Wie kann es sein, dass der effektive Steuersatz auf die Einkommen der reichsten Personen eines Landes weit unterhalb des geltenden Höchststeuersatzes liegt? Und warum gelingt es der Schweiz, Milliardärinnen und Milliardäre angemessener zu besteuern?
Steuergeschenke in großem Stil
Das progressive Steuersystem ist darauf ausgerichtet, die breite Masse der arbeitenden Bevölkerung zu besteuern. Arbeitseinkommen werden in der Regel vollständig dem progressiven Einkommensteuertarif unterworfen. Das bedeutet, dass auch der Vorstand eines DAX-Unternehmens auf sein Millioneneinkommen den Reichensteuersatz zahlt. Ebenso zahlen Milliardärinnen und Milliardäre, sofern sie arbeiten, diesen Steuersatz auf ihre Arbeitseinkommen (Aufsichtsratsvergütungen oder Geschäftsführergehälter).
Allerdings machen diese Einkommensquellen nur einen geringen Anteil ihres Gesamteinkommens aus. Das Einkommen der Superreichen besteht zum größten Teil aus den Gewinnen und Dividenden ihrer Unternehmen sowie aus den Renditen ihrer Investitionen. Im Gegensatz dazu bestreiten die Durchschnittsverdienenden ihren Lebensunterhalt hauptsächlich mit Arbeitseinkommen. Entscheidend für die Besteuerung der Reichen ist also die Besteuerung der Vermögenseinkommen, vor allem – aber nicht nur – aus Unternehmensbeteiligungen.
»Entscheidend für die Besteuerung der Reichen ist also die Besteuerung der Vermögenseinkommen, vor allem – aber nicht nur – aus Unternehmensbeteiligungen.«
Unternehmensgewinne unterliegen in allen drei Ländern einer zweistufigen Besteuerung. Zunächst werden die Gewinne im Unternehmen selbst besteuert. Die unternehmensbezogenen Steuersätze variieren zwischen durchschnittlich 13 Prozent in der Schweiz, 23 Prozent in Österreich und im Schnitt 30 Prozent in Deutschland. Sowohl innerhalb der Schweiz als auch in Deutschland gibt es aber Kantone beziehungsweise Kommunen, die deutlich niedrigere Steuersätze verlangen.
Im Schweizer Kanton Zug liegt der Steuersatz beispielsweise unter 12 Prozent und in deutschen Gemeinden mit sehr niedrig angesetzter Gewerbesteuer fällt der Steuersatz auf bis zu 23 Prozent. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ausnahmen, beispielsweise für Erträge aus Patenten oder aus Mieteinnahmen. Gerade die größten und profitabelsten Unternehmen schaffen es mit aggressiver Steuergestaltung einen großen Teil ihrer Gewinne in sogenannte Steuersümpfe zu verschieben.
Im zweiten Schritt werden die Unternehmensgewinne bei der Ausschüttung an die Anteilseignerinnen und Anteilseigner besteuert. Auf diese Kapitalerträge sind in Deutschland 26,4 Prozent und in Österreich 27,5 Prozent Steuern zu zahlen. In der Schweiz wird – bei einer Beteiligung von mehr als 10 Prozent – ein Teil des ausgeschütteten Gewinns steuerbefreit und der Rest zum Einkommensteuersatz versteuert. In Kombination mit den gesetzlichen Unternehmenssteuern entspricht diese Schweizer »Gewinnsteuer« weitgehend den Höchststeuersätzen der Einkommensteuer.
Allerdings kann die zweite Stufe der Besteuerung in allen drei Ländern vermieden werden, indem die Anteile am Unternehmen über vermögensverwaltende Gesellschaften gehalten werden. Wird der Gewinn an solche Gesellschaften ausgeschüttet, fällt keine Steuer oder nur ein Bruchteil dessen an, was Kleinaktionärinnen auf ihre Kapitalerträge zahlen. Wenn die in der vermögensverwaltenden Gesellschaft angesparten Gewinne reinvestiert werden, profitieren deren Eigentümer vom Zinseszins-Effekt. Dieser sorgt dafür, dass ihre niedrig besteuerten Vermögen noch schneller wachsen als ohnehin.
»Eine Übertragung des Schweizer Modells der Besteuerung von Vermögen, Erbschaften und Schenkungen auf Deutschland würde hierzulande die Vermögensteuereinnahmen drastisch erhöhen: von aktuell 9 auf 73 Milliarden Euro.«
Lediglich in der Schweiz sorgt die Vermögensteuer dafür, dass die Steuersätze von Hochvermögenden deutlich näher an den jeweiligen Höchststeuersätzen liegen. Die Vermögensteuer wirkt wie eine indirekte Steuer auf Vermögenserträge, der man sich auch durch Beteiligungsstrukturen nicht entziehen kann. Egal ob die Unternehmensanteile direkt oder über andere Gesellschaften gehalten werden – Vermögende müssen sich einen Teil der Gewinne auszahlen lassen, um daraus die Vermögensteuer zu begleichen.
Steuerflüchtlinge werden bevorzugt
Warum ist die Schweiz bei Steuerflüchtlingen dennoch so beliebt? Das liegt daran, dass ausländische Vermögende eine Vergünstigung erhalten, die Schweizer Staatsbürgern nicht zuteilwird. Menschen ohne Arbeitseinkommen, die ihr Steuerdomizil in die Schweiz verlegen, zahlen nur eine pauschale, stark reduzierte Vermögensteuer. Dabei wird das Vermögen typischerweise auf das Zwanzigfache der jährlichen Durchschnittsausgaben festgesetzt und damit das Vermögen der Superreichen massiv unterschätzt. Zieht man in einen Niedrigsteuerkanton, lassen sich noch mehr Steuern sparen. Insgesamt ist die Vermögensteuer in der Schweiz so niedrig, dass nur wer keine oder kaum Erträge auf das Vermögen erwirtschaftet, die Steuer aus der Substanz des Vermögens bezahlt. Aus diesem Grund vermag sie die Vermögensungleichheit nur mäßig zu mindern.
Dennoch zeigt die Schweiz: Eine Vermögensteuer ist trotz des Wettbewerbsdrucks von Kantonen und Staaten möglich. Mit immerhin knapp 7 Prozent trägt sie zum Steueraufkommen der Schweiz bei. Ein weiteres Prozent stammt aus Steuern auf Erbschaften und Schenkungen. Eine Übertragung des Schweizer Modells der Besteuerung von Vermögen, Erbschaften und Schenkungen auf Deutschland würde hierzulande die Vermögensteuereinnahmen drastisch erhöhen: von aktuell 9 auf 73 Milliarden Euro.
Die in Brasilien und in den USA diskutierte Vermögensteuer von 2 Prozent würde den Steuersatz der deutschen Beispiel-Milliardärinnen auf etwa 35 Prozent ihres Einkommens erhöhen. Gäbe es außerdem eine Mindeststeuer von 25 Prozent auf das wirtschaftliche Einkommen, müssten die BMW-Erben insgesamt rund 43 Prozent auf ihre Milliardeneinkommen abführen. Auch diese Zahl liegt noch unterhalb des geltenden Reichensteuersatzes. Zumindest aber wäre dafür gesorgt, dass die Milliardenvermögen weniger schnell wachsen. Über das Steuersystem lassen sich nicht alle Probleme lösen, aber die Zahlen zeigen: das Umsteuerungspotential ist groß und man muss nicht auf internationale Lösungen warten.
In der Diskussionen der attac-Gruppe Flensburgs seit dem Herbstratschlag attacs in 2023, haben wir unterschiedliche Aspekte der Entwicklung diskutiert und sind zu der folgenden Überlegung gekommen: Eine eindeutige Beurteilung der internen chinesischen Entwicklung und der chinesischen Außenpolitik haben wir nicht treffen können - genauso wenig wie eine Positionierung, ob wir es hier mit einem kapitalistischen oder sozialistischen Land zu tun haben.
In der Arbeit mit dem chinesischen Belt and Road Initiative haben wir z.B. den Eindruck bekommen, dass es fraglich ist, wie in dem attac-Positionspapier aus dem Herbst 2023 die internationale Rolle Chinas charakterisieren wird. Es liegt teilweise daran, dass die internationalen chinesischen Investitionen nicht einhundert Prozent zentral gesteuert werden, sondern auch häufiger den Provinzen überlassen worden sind. Das führt dazu, dass in den konkreten Untersuchungen der außenwirtschaftlichen Beziehungen Chinas immer wieder Widersprüche auftauchen, die einerseits den Eindruck hinterlassen, dass China eher eigene nationale wirtschaftliche Interessen verfolgt, aber andererseits auch Projekte unterstützt, die von unterschiedlichen Staaten im globalen Süden gewünscht werden und in deren eigenem Interesse sind. Manchmal gibt es Beispiele, bei denen es Vorteile für beide Seiten gleichzeitig zu geben scheint, was von offizieller chinesischer Seite vermutlich als Ausdruck dafür gewertet wird, dass die chinesische Außenpolitik auf dem Prinzip des gegenseitigen Nutzens beruht.
Die weitere Frage ist, welche Bedingungen erfüllt werden müssen, um die Politik eines erklärten sozialistischen Landes auch als sozialistisch bezeichnen zu können, und wie diese Politik konkret empirisch zu erfassen wäre.
Es ist eine wichtige Aufgabe für attac, solches zu präzisieren, so dass eine fundierte Grundlage für unsere Schlussfolgerungen aufgebaut werden können.
In Verlängerung von Ingar Soltys Vortrag bei attac am 22.1.2024 haben wir auch diskutiert, wie wir damit umgehen sollen, dass China auf der einen Seite gigantische Unterschiede in der Verteilung des Privatvermögens hat, aber auf der anderen Seite dafür gesorgt hat, dass hunderte Millionen Menschen aus der Armut geholt worden sind. ... sowie dass China einerseits Anfang des 21. Jh. eine riesige Privatisierungswelle ausgelöst hat, aber andererseits in den letzten 10-15 Jahren die Partei verstärkt die Produktion in den einzelnen Firmen kontrollieren und Fälle von Korruption drakonisch verfolgen lässt. Und wir diskutieren über ein Land, wo Grund und Boden immer noch Staatseigentum ist. Ist das Kapitalismus - und wenn ja, welche Form von Kapitalismus?
Die chinesische Entwicklung seit 1949 ist überaus widersprüchlich. In der Zeit Maos wurde der Klassenkampf und die Mobilisierung des Volkes als das zentrale Kennzeichen einer sozialistischen Gesellschaft angesehen. Das wird in der ChKP seit einigen Jahrzehnten zurückgewiesen und stattdessen sind Besitzer von Firmen, Privateigentümer in der Partei als Mitglieder aufgenommen worden. Wie ist das zu bewerten? Bedeutet es, dass sich die Geschäftsinhaber der Politik der Partei unterwerfen müssen - oder ist es ein Ausdruck dafür, dass die Politik der Partei mit den Interessen der Geschäftsinhaber identisch ist? Deng Xiaoping glaubte an den trickle-down-Effekt und machte ihn damit bei rasant wachsenden wirtschaftlichen Unterschieden gesellschaftsfähig. Heute gibt es Anzeichen dafür, dass diese Unterschiede nicht mehr unwidersprochen akzeptiert werden und dass hinter dem Kampf gegen die Korruption der Versuch der Partei steht, mehr Entscheidungsgewalt über die wirtschaftliche Entwicklung zu erlangen.
In der internationalen politischen Entwicklung spielt die neue Front der G7-Staaten unter der Führung der USA gegen China eine zentrale Rolle - das gilt unabhängig davon, ob Republikaner oder Demokraten in Washington das Sagen haben. Wie sollen wir uns dazu positionieren? Ist es ein Vorteil für die Chinesen und für die Völker der übrigen Welt, eine unilaterale Welt zu haben, die von den Vereinigten Staaten angeführt wird, oder ist es besser, wenn es eine multipolare Welt gibt, in der China - wenn auch widersprüchlicher - Teil des Widerstands gegen den US-Imperialismus sein kann?
Es ist eine große, notwendige Herausforderung für attac, hier eine gründliche Analyse zu organisieren.
Die undifferenzierte pauschale negative Bewertung Chinas durch das 2023 verabschiedete Positionspapier "Globalisierungskritik neu denken" entspricht in jedem Fall nicht den bislang publizierten Diskussionen im Attac-Rahmen.
Morten + Henning, 03.03.24
Ich habe einige Texte aus diversen Zeitungen / Zeitschriften und anderen Quellen (z.B. der RLS) beschafft und präsentiere sie hiermit als Diskussionsmaterial zusammen mit den Vorschlägen, die aus unserem Arbeitskreis bislang vorgelegt wurden. Über die eingeblendeten Links kommt ihr zu den digitalen Original-Texten.
Ich denke, daraus lässt sich zumindest ein Weg zu mehr Erkenntnis finden.
Beste Grüsse,
Henning
______________________________________________
Linke streiten über die richtige Sichtweise auf China
Solidarität mit wem?
Felix Wemheuer ist Professor für Moderne China-Studien an der Universität zu Köln.
In großen westlichen Medien wird die Debatte über China gegenwärtig emotional geführt und ist von politischen Bekenntnissen zum »Kampf der Demokratien gegen Autokratien« geprägt. Die Wahrnehmung hat sich von Chancen auf dem »Markt der Zukunft« zu Sorgen um wirtschaftliche Abhängigkeit von der Volksrepublik verschoben. Bei Linken gehen die Positionen beim Thema China weit auseinander. Für Linke wie auch für die bürgerliche Nationalökonomie passt der rasante Aufstieg eines Mischsystems aus leninistischer Parteibürokratie und Marktelementen nicht ins ursprüngliche Weltbild. Im Unterschied zum Englischen oder Spanischen gibt es eine große Sprachbarriere, da in Deutschland nur wenige – zumeist Sinologen – chinesischsprachige Debatten verfolgen können.
Einige Linke versuchen, sowohl an den geostrategischen Ambitionen der USA als auch am »chinesischen Kapitalismus« Kritik zu üben. Seit Jahren dokumentiert zum Beispiel die Website Gongchao.org Streiks und soziale Kämpfe in China und solidarisiert sich mit diesen. Der Kreis um Ralf Ruckus hat zahlreiche Bücher von kritischen chinesischen Wissenschaftler:innen und Aktivist:innen ins Deutsche übersetzt. Die Themen variieren: Es gibt Interviews mit jungen Fabrikarbeiterinnen, Berichte von Streiks beim iPhone-Produzenten Foxconn und historische Studien zu linkskommunistischen Strömungen in der Kulturrevolution. Auch das »Forum Arbeitswelten« organisiert seit Jahren einen solidarischen Austausch und Kontakte von kritischen Gewerkschafter:innen und Aktivist:innen aus Deutschland und China.
Der Wunschtraum hat sich nicht erfüllt
Nach einer großen landesweiten Streikwelle im Jahr 2010 hegten diese Linken die Hoffnung, dass China zum neuen globalen Zentrum für Arbeitskämpfe werde und das kapitalistische Weltsystem ins Wanken gerate. Die damaligen Streiks waren selbstorganisiert und nicht von den staatlichen Gewerkschaften unterstützt. Unabhängige Gewerkschaften sind in China nicht zugelassen. Der Wunschtraum von 2010 hat sich nicht erfüllt. Dennoch finden auch unter der verschärften Repression seit dem Machtantritt Xi Jinpings 2012 weiterhin Arbeitskämpfe statt. Im Dezember organisierten die Rosa Luxemburg-Stiftung und das »Kritische China-Forum« eine Konferenz zu »Arbeitskämpfen in der Plattformökonomie am Beispiel von Essenskurieren in China und Deutschland«, an der auch Aktivist:innen aus der Volksrepublik teilnahmen.
Das »Kritische China-Forum« wurde Anfang 2021 ins Leben gerufen, um eine linke Debatte anzuregen und Expertise zu bündeln. Es möchte Herrschaftsverhältnisse, kapitalistische Ausbeutung und Naturzerstörung in China thematisieren. Dennoch will man gegen schlichtes Schwarzweiß-Denken, Chauvinismus und militärische Eskalationslogik im westlichen Mainstream Stellung beziehen. In diesem Forum engagieren sich Mitarbeitende verschiedener Universitäten, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der NGO Power Shift sowie Mitglieder von Gongchao, des Forums Arbeitswelten, der IG Metall, der IG BCE und der Bildungsgewerkschaft GEW.
Ursprünglich war geplant, dass das Forum eine kontroverse Debatte mit allen linken Strömungen führen solle. Interesse von den Unterstützenden des »Sozialismus mit chinesischer Besonderheit« blieb jedoch weitgehend aus. Als Folge sind im Forum Menschen vertreten, die die Volksrepublik als »kapitalistisch« oder »staatskapitalistisch« einordnen. Als Argumente für diese Einschätzung werden genannt: die große Privatisierungswelle und Massenentlassungen der späten Neunziger, Umwandlung vieler Staatsbetriebe in Aktiengesellschaften, der nur schwach regulierte Arbeitsmarkt, die mangelhafte Implementierung von Arbeitsrechten und Arbeitsschutz sowie der Landnutzungsrechte und starke Kommerzialisierung des Wohnungsmarktes sowie des Bildungs- und Gesundheitssystems.
Kontroverse Meinungen gibt es zum Beispiel bei der Frage der Bewertung der Protestbewegung in Hongkong (2019–2020). Einige bewerten die Proteste gegen die autoritäre Regierung überwiegend positiv und stehen im Austausch mit dem linken Flügel der Demokratiebewegung. Andere sehen diese Bewegung wegen der geopolitischen Instrumentalisierung durch die US-Regierung hingegen überwiegend kritisch.
Bisher orientieren sich chinesische Superreiche und die Mittelschicht am Konsumstandard der »imperialen Lebensweise«.
Vor dem Hintergrund der Verschärfung des sino-amerikanischen Konflikts gibt es eine Strömung innerhalb der Linken, deren Haltung zur Volksrepublik in erster Linie von geopolitischen Überlegungen bestimmt wird. Ihr prominentester Vertreter ist wohl der Journalist Jörg Kronauer, der regelmäßig in Konkret und Junge Welt veröffentlicht. Er behauptet nicht, dass in der Volksrepublik der Sozialismus aufgebaut werde. Kronauer sieht Chinas emanzipatorisches Potential vielmehr im Versuch, das wirtschaftlich-technisch abgesicherte Wohlstandsmonopol westlicher Mächte global zu brechen.
Soziale Kämpfe und politische Auseinandersetzungen innerhalb Chinas kommen in seinen Artikeln so gut wie gar nicht vor. Die rasante Aufrüstung der Volksbefreiungsarmee und den aggressiveren Umgang der chinesischen Regierung mit kleineren Nachbarstaaten sieht Kronauer in erster Linie nur als Reaktion auf die militärische und wirtschaftliche Eindämmungspolitik der USA in Asien. Eine eigene chinesische imperialistische Agenda will Kronauer nicht erkennen.
Für eine internationale Solidarität mit der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und dem chinesischen Modell tritt eine Gruppe um den letzten Vorsitzenden des Ministerrats der DDR und langjährigen Vorsitzenden des Ältestenrats der Partei »Die Linke«, Hans Modrow, ein. Modrow, der im Alter von 95 Jahren am 11. Februar verstorben ist, besuchte schon 1959 die Volksrepublik als Leiter einer Delegation der Freien Deutschen Jugend.
Die SED bekämpfte den Maoismus
2021 erschien das Buch »Chinas Jahrhundert: Werkstattgespräch« (Herausgeber Michael Geiger), in dem eine Reihe von in der DDR sozialisierten ehemaligen Funktionären und Wissenschaftlern über ihre Erfahrungen reflektieren. Im Rahmen des sino-sowjetischen Konflikts nach 1963 hatte die SED den Maoismus ideologisch bekämpft. Als sich ab 1984 die Beziehungen zwischen der UdSSR und China wieder verbesserten, entwickelte sich auch ein reger politischer und wissenschaftlicher Austausch zwischen der DDR und der Volksrepublik.
Der Tenor dieser Strömung ist, dass die westliche Linke das Projekt des »chinesischen Sozialismus« ernst nehmen sollte. Die KPCh habe wichtige Lehren aus dem Scheitern der traditionellen Plan- und Staatswirtschaft sowjetischen Typs gezogen. Mit einer Mischung aus verschiedenen Eigentumsformen sowie Markt- und Planelementen sei es der KPCh gelungen, sowohl Wachstum und Wohlstand zu schaffen als auch den Primat der Politik über die Ökonomie zu wahren.
Modrow selbst hatte 1989 vergeblich versucht, die DDR mit marktorientierten Reformen zu retten. Neben den Lehren, die aus dem gescheiterten Maoismus gezogen worden seien, sei der chinesische Weg auch von den eigenen kulturellen Traditionen des Landes wie der des Konfuzianismus geprägt. Viele westliche Linke hätten einen »eurozentrischen« Blick und würden schematisch veraltete Vorstellungen von Sozialismus versus Kapitalismus bei der Bewertung Chinas anwenden.
Der Ökonom Uwe Behrens, der im DDR-Verkehrswesen tätig war und nach 1990 für verschiedene Logistikunternehmen in China arbeitete, sieht die »Neue Seidenstraße« als ein Menschheitsprojekt und Alternative zur US-dominierten Weltordnung. Berichte in westlichen Medien über schwere Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang oder Hongkong tut diese Strömung in der Regel als »China-Bashing« oder »Propaganda des US-Imperialismus« ab.
Berechtigte Skepsis bei der Berichterstattung westlicher Mainstream-Medien scheint von keiner kritischen Auseinandersetzung mit offiziellen chinesischen Darstellungen begleitet zu werden. Im Gegenteil sind Behrens und andere gerngesehene Interviewpartner der chinesischen Staatsmedien, die sich ihre Version der Geschehnisse von »Ausländern« bestätigen lassen.
Sympathien jenseits dogmatischer Debatten
Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP), die sich eng an die Sowjetunion angelehnt hatte, soll einem Antrag des Parteivorstands zufolge auf dem nächsten Parteitag im März die Einschätzung beschließen, die KPCh in China baue den Sozialismus auf. Die chinesischen Genossen hätten souverän verhindert, dass sich eine neue Bourgeoisie als Klasse entwickelt habe. Die Partei behalte die Kommandohöhen der Wirtschaft und die Macht im Staat.
Unumstritten ist diese Position allerdings nicht. In der Parteizeitung Unsere Zeit vertrat Inge Humburg Ende Januar mit Verweis auf Josef Stalin die Position, die Warenproduktion, sprich Marktelemente, sei ein »Muttermal des Kapitalismus«. Mit der Weiterentwicklung zum Kommunismus müsse die Warenproduktion durch umfassende staatliche Planung ersetzt werden. Der Parteivorstand der DKP habe sich mit der positiven Haltung zur »sozialistischen Marktwirtschaft« der KPCh von seinen kommunistischen Wurzeln entfernt.
Jenseits solcher dogmatischen Debatten führen auch die Fähigkeiten des chinesischen Staats, in großem Stil Infrastruktur zu errichten, zu Sympathien. So stellt zum Beispiel der Bremer Professor für Volkswirtschaftslehre Wolfram Elsner diese Handlungsfähigkeit einem sich angeblich im Niedergang befindlichen westlichen Kapitalismus gegenüber. Der Neoliberalismus habe durch Deregulierung, Privatisierung und Unterfinanzierung die Fähigkeit des Staats zur Intervention stark geschwächt. In China habe der Staat die Handlungsfähigkeit dagegen bewahrt und den Willen, einen grundlegenden ökologischen Umbau im Kampf gegen die Klimakatastrophe zu gestalten. Ähnlich argumentieren auch einige Anhänger:innen keynesianischer Wirtschaftspolitik. Sie hoffen, durch die Konkurrenz des erfolgreichen chinesischen Modells könne im Westen die industriepolitische Steuerung von Märkten wiederbelebt werden.
Die »Handlungsfähigkeit« des chinesischen Staats zeigt sich jedoch auch in dem Aufbau umfassender digitaler Überwachung, der Wiedereinführung des Systems von »Umerziehungslagern« außerhalb des offiziellen Justizwesens und der Gängelung von Wissenschaft und Kultur in exorbitantem Ausmaß. Ob ein ökologischer Umbau durch den Staat von oben, ohne entsprechenden gesellschaftlichen Bewusstseinswandel, gelingen kann, wird sich zeigen. Bisher orientieren sich chinesische Superreiche und die Mittelschicht am Konsumstandard der »imperialen Lebensweise« (Brand/Wissen).
In der Partei »Die Linke« und der ihr nahestehenden Rosa-Luxemburg-Stiftung werden Stimmen laut, das Verhältnis zu China endlich zu klären. Da alle hier umrissenen Positionen in Partei und Stiftung vorhanden sind, besteht wohl keine Aussicht auf einen Konsens.
Der Aufstieg der Volksrepublik China verändert die Welt. Dies ist der Auftakt einer Disko-Reihe der jungle-world über linke Positionen zu China.
__________________________________________________________________
Thomas Sablowski (RLS)
Von der amerikanisch-chinesischen Rivalität zur Deglobalisierung? (...)
Fazit
Einige Kennziffern für die Internationalisierung des Kapitals deuten, wie oben ge-
zeigt wurde, auf eine zumindest gebremste Globalisierung hin. Insbesondere der
Übergang von einer exportorientierten zu einer stärker binnenzentrierten Entwick-
lungsweise in China und die US-amerikanischen Versuche, den weiteren Aufstieg
Chinas in der hierarchischen internationalen Arbeitsteilung zu verhindern sowie
die eigene technologische, wirtschaftliche, politische und militärische Vorherr-
schaft zu verteidigen, sind hier von Belang.
Die EU schwankt zwischen einer Unterordnung unter die USA und dem Versuch,
durch eigene industriepolitische Programme die eigene Position gegenüber den
USA und China zu stärken.
Durch Maßnahmen wie die chinesischen Einschränkungen des freien Internetverkehrs
und die US-amerikanischen Exportverbote in der Halbleiterindustrie kommt es zu
einer partiellen wirtschaftlichen und technologischen Entkopplung zwischen den
rivalisierenden Mächten. Schreitet diese Entwicklung weiter voran, so könnte
auch die Kriegsgefahr wachsen, wenngleich der Krieg in der Ukraine zeigt, dass
auch wechselseitige wirtschaftliche Abhängigkeiten einen Krieg nicht unbedingt
verhindern (vgl. Solty 2020).
Ich halte allerdings eine umfassende „Entkopplung“ zwischen China und den USA
bzw. dem „Westen“ weiterhin eher für unwahrscheinlich, da die Verflechtungen,
die sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, ein großes Gewicht haben,
so dass auch starke (Kapital-)Interessen gegen eine umfassende „Entkopplung“ sprechen.
Realistischer scheint mir, dass die Deglobalisierung auf einzelne Bereiche beschränkt
bleibt. Kein Land und keine Ländergruppe kann heute angesichts der tiefen internationalen
Arbeitsteilung eine Autarkie realisieren. Eine umfassendere Deglobalisierung würde
jedenfalls die Produktionskosten deutlich erhöhen und wäre allenfalls unter katastrophischen
Bedingungen, etwa im Kontext einer Kriegswirtschaft, denkbar. In der aktuellen
geopolitischen Konfrontation geht es eher darum, die eigene Erpressbarkeit ein
Stück weit zu reduzieren bzw. die Erpressbarkeit der Gegner aufrechtzuerhalten.
Dafür spielen Monopole in bestimmten Produktionsbereichen eine zentrale Rolle.
Welche Länder Spitzenpositionen in der internationalen Arbeitsteilung einneh-
men, aus denen sich entsprechende ökonomische und politische Machtpotentiale
ableiten lassen, hängt davon ab, inwieweit diese die Entwicklung von neuen Pro-
dukten und Produktionsprozessen beherrschen und selbst Schrittmacher bei der
Entwicklung der Arbeitsproduktivität, der Produktions- und Konsumnormen sind.
Dies ist der zentrale Gegenstand der gegenwärtigen geopolitischen Konflikte.
Notwendig wäre statt der aktuell nach imperialistischen Gesichtspunkten erfol-
genden selektiven Deglobalisierung eine Restrukturierung der globalen Produkti-
on nach sozialökologischen Kriterien, die durchaus auch zu einer völlig veränder-
ten Geographie und einer stärkeren Regionalisierung in vielen Bereichen führen
könnte bzw. müsste. Dies wäre gewissermaßen eine Deglobalisierung von unten
und nicht zuletzt eine Deglobalisierung im Interesse des Globalen Südens, wie sie
etwa Walden Bello schon vor vielen Jahren thematisierte.
Essay aus:
file:///C:/Users/Ich/AppData/Local/Temp/pid-1164/Sablowski%202023%20Deglobalisierung_Z%20134.pdf
https://www.vsa-verlag.de/uploads/media/www.vsa-verlag.de-Mueller-China-neuer-Hauptfeind.pdf
Wolfgang Müller - China: neuer Hauptfeind des Westens?
Nach 100 Jahren Erniedrigung will das Land der Welt auf Augenhöhe begegnen (erschienen Frühjahr 2023, hier ein Buch-Auszug)
Wie kann und wie muss man China diskutieren?
von Jan Turowski - Jan Turowski leitet das Beijing-Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Dieser Artikel erschien in der gewerkschafts-orientierten Zeitschrift "Sozialismus", Heft 7/8-2023.
Dieser Artikel liegt hier vor - Kopie.
Worum geht es beim chinesisch-amerikanischen Konflikt um Taiwan? Vor allem um die Halbleiterindustrie
Raul Zelik (ein Buchtipp)
Krisen sind wie Nachhilfe: Nachdem man in der Bankenkrise 2008 lernen konnte, wie die Finanzmärkte funktionieren, wurde die Corona-Pandemie zum Crashkurs über Wertschöpfungsketten. Damals wurden mit den Halbleiter-Chips nicht nur die Grafikkarten und Computer knapp, sondern auch bei Autos und Kühlschränken war man plötzlich mit langen Lieferzeiten konfrontiert.
Zwei Lektionen blieben hängen: Es gibt heute praktisch keinen Gebrauchsgegenstand mehr, der ohne Chips gebaut werden kann, und der Weltmarkt für Halbleiter ist von einem einzigen Anbieter abhängig – der Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company. Zwar musste TSMC während der Pandemie gar nicht in den Lockdown, doch da westliche Konzerne ihre Bestellungen storniert hatten, war der taiwanesische Hersteller neue Lieferverpflichtungen eingegangen.
Dass diese Abhängigkeit von Halbleitern auch eine geopolitische Dimension besitzt, liegt auf der Hand. Oder wie es der in Massachusetts lehrende Historiker Chris Miller in der Einleitung zu seinem Buch »Der Chip-Krieg« ausdrückt: »Noch kontrollieren die USA den Markt für Siliziumchips, die dem Silicon Valley seinen Namen gegeben haben. Diese Vormachtstellung ist jedoch bedroht. China gibt inzwischen jedes Jahr mehr für den Import von Chips aus als für Öl (…) Um die Halbleiterindustrie aus dem Würgegriff Amerikas zu befreien, investiert das Land Milliarden von Dollar in die Entwicklung der eigenen Chiptechnologie (…) Ist diese Strategie erfolgreich, wird Peking die Weltwirtschaft umgestalten und das militärische Gleichgewicht neu justieren können.«
Doch bevor sich der Historiker Miller seinem eigentlichen Thema, nämlich diesem Kampf um die ökonomisch-geopolitische Vorherrschaft zuwendet, zeichnet er zunächst die Geschichte der Halbleitertechnologie nach. Kenntnisreich und detailliert schildert er, wie Transistoren ab den 40er Jahren erst Rüstungswettlauf und Raumfahrt, dann auch die Konsumgüterindustrie revolutionierten und wie die Verbreitung dieser Technik durch die Konkurrenz zwischen den USA und der Sowjetunion, später auch zwischen den USA und Japan konditioniert wurde.
In diesem ersten Teil verliert sich Chris Miller streckenweise ein wenig in den Biografien von Entwicklern und Unternehmern, die er allzu enthusiastisch als genialische Machertypen idealisiert. Richtig spannend wird das Buch, wenn sich Miller der Gegenwart und damit der Frage nähert, warum die globale Halbleiterproduktion heute eigentlich in Taiwan konzentriert ist.
In diesem Zusammenhang ist wichtig, dass die USA bei den PC-Prozessoren über Intel nach wie vor Weltmarktführer sind. Das große Problem heute sind jene Chips, die beispielsweise in Rüstungsgütern, Haushaltsgeräten oder Autos zum Einsatz kommen. Je nach Anwendung werden hierfür spezifische Halbleiter-Architekturen entwickelt, und zwar von Ingenieursfirmen in aller Welt. Da diese Chips immer kompakter werden – die Halbleiterbeschichtung ist teilweise nur noch wenige Atome dick –, wird auch die Fertigung immer anspruchsvoller.
An dieser Stelle schließlich kommt Taiwan ins Spiel: Das Geschäftsmodell von TSMC hat sich von Anfang an darauf beschränkt, die von anderen Herstellern entworfenen Chips zu fertigen. Aus diesem Grund wurde das taiwanesische Unternehmen von anderen Firmen nicht als Konkurrent wahrgenommen und gern als Auftragnehmer gewählt. Mehr als die Hälfte der globalen Halbleiter-Auftragsfertigung wird mittlerweile in TSMC-Werken abgewickelt – bei den modernsten Chips soll der Anteil sogar über 90 Prozent liegen.
Diese Monopolstellung ist für die Weltwirtschaft ein Riesenproblem: Eine chinesische Seeblockade, ein schweres Erdbeben in der Region oder eine politische Krise in Taiwan würden die Industrie weltweit zum Erliegen bringen. Doch eine vergleichbare Halbleiterproduktion an anderen Orten der Welt aufzubauen, ist, wie Miller anschaulich skizziert, weitaus komplexer als gemeinhin angenommen.
Produziert werden moderne Halbleiter heute nämlich mithilfe eines Fotolithografie-Verfahrens, bei dem extrem ultraviolette Strahlung (EUV) zum Einsatz kommt. Miller schildert die technischen Herausforderungen genüsslich: »Am besten erzeugen lässt sich die EUV-Strahlung, indem man einen winzigen Zinntropfen mit einem Durchmesser von 30 Mikrometern mit einer Geschwindigkeit von circa 320 Kilometern pro Stunde durch ein Vakuum schießt. Das Zinn wird dann zweimal mit einem Laser bestrahlt, wobei der erste Impuls das Zinn erwärmt und der zweite es in ein Plasma mit einer Temperatur von etwa einer Million Grad verwandelt – ein Vielfaches der Oberflächentemperatur der Sonne. Dieser Prozess des Bestrahlens von Zinn wird dann 50 000 Mal pro Sekunde wiederholt, um EUV-Strahlung in der für die Herstellung von Chips erforderlichen Menge zu erzeugen.«
Für das von einem US-Unternehmen entwickelte, von der niederländischen Firma ASML eingesetzte Belichtungsverfahren werden Hochpräzisionslaser sowie Spiegel benötigt, die wiederum nur von anderen hoch spezialisierten Firmen unter anderem in Deutschland gebaut werden können. Die besondere Leistung von TSMC besteht darin, dass es eine Vielzahl von Einzelkomponenten zu einer funktionierenden Fertigungsanlage zusammengesetzt hat.
Und das erklärt schließlich auch, warum sich Halbleiterfabriken nicht einfach nachbauen lassen. Nötig sind hier nicht nur Milliarden-Investitionen, sondern auch enge Geschäftsbeziehungen zu globalen Partnern. In den USA und in Deutschland hat man das Problem dadurch zu lösen versucht, dass man TSMC mithilfe von Milliarden-Subventionen zum Aufbau von Werken in den eigenen Ländern bewegt hat. Doch wie Miller anmerkt: »Keine der neuen Fabriken wird mit der Produktion der allermodernsten Chips betraut werden, sodass die fortschrittlichste Technologie von TSMC in Taiwan verbleiben wird.«
Noch komplizierter ist die Lage für China, das jährlich etwa 200 Milliarden Euro für importierte Halbleiter ausgibt – mehr als für Öl. Staatschef Xi hat den Aufbau einer eigenen Halbleiterindustrie zwar zum strategischen Ziel erklärt. Doch die wachsenden Spannungen mit dem Westen stehen einer allzu engen Kooperation der globalen Marktführer mit den chinesischen Halbleiterproduzenten im Weg. Peking muss also nicht nur die Chipfabriken, sondern auch hoch spezialisierte Maschinenbauunternehmen aus dem Boden stampfen, die beispielsweise die für das Lithografie-Verfahren benötigten Laser herstellen können. Das dürfte mindestens ein Jahrzehnt in Anspruch nehmen.
Sowohl das chinesische Pathos zur nationalen Wiedervereinigung mit Taiwan als auch die Demokratie-Rhetorik des Westens verschleiern also, worum es hauptsächlich gehen dürfte: Wenn Peking die taiwanesische Halbleiterindustrie unter Kontrolle bekäme, besäße es ungeheure ökonomische Macht. Aus diesem Grund müssen die USA eine Vereinigung von China und Taiwan mit allen Mitteln verhindern. Gleichzeitig wäre ein Krieg aber auch für alle Beteiligten verheerend, denn ohne die Halbleiter aus Formosa käme die Weltwirtschaft zum Erliegen, was globale soziale Unruhen nach sich ziehen dürfte. Und für Taiwan schließlich ist die Chipindustrie, wie es Staatspräsidentin Tsai Ing-wen formuliert hat, »ein Schutzschild aus Silizium«. Solange der Westen taiwanesische Halbleiter benötigt, wird man das Land nicht fallen lassen.
Die große Leistung Chris Millers besteht darin, dass er diese komplexen technologischen, unternehmerischen und geopolitischen Fragen gut verständlich erklärt. Die Welt von heute ist sowohl durch extreme gegenseitige Abhängigkeit als auch durch nationalstaatliche Konkurrenz geprägt – eine brandgefährliche Gemengelage. Mehr als Öl und Rohstoffe stehen dabei winzige Technologiegüter im Mittelpunkt der Auseinandersetzung.
Chris Miller: Der Chip-Krieg. Wie die USA und China um die technologische Vorherrschaft auf der Welt kämpfen. A. d. amerik. Engl. v. Hans-Peter Remmler u. Doro Siebecke. Rowohlt, 500 S., geb., 30 €.
Während des G20-Gipfeltreffens in Neu-Delhi am 9. September haben die relevanten Staatschefs ein »Memorandum of Understanding« (MoU), also eine rechtlich unverbindliche und inhaltlich substanzlose Absichtserklärung, veröffentlicht. Gegenstand des kurzen Papiers ist die Schaffung eines »Wirtschaftskorridors Indien–Nahost–Europa«, englisch abgekürzt IMEC. Unterschrieben haben Saudi-Arabien, Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Frankreich, die BRD, Italien, die USA und die EU.
Der geplante IMEC soll der Absichtserklärung zufolge aus zwei separaten Korridoren bestehen: einem östlichen, der Indien mit der arabischen Halbinsel verbindet, und einem nördlichen, der von dort aus nach Europa weiterführt. Der erste Abschnitt soll vom indischen Mumbai (früher Bombay) über See zu Häfen in den Emiraten oder Saudi-Arabien verlaufen. Dazu steht zwar im MoU nichts Genaues, aber laut Presseberichten sind fünf verschiedene Häfen zur Auswahl ins Auge gefasst.
Zentraler Teil des Projekts ist eine noch zu bauende Eisenbahnlinie, die durch Saudi-Arabien über Jordanien weiter nach Israel führen soll. Dort sollen die zu transportierenden Güter vermutlich – auch das wird in dem Papier nicht konkretisiert – im Hafen von Haifa wieder auf Schiffe geladen und über das Mittelmeer nach Europa gebracht werden. Entlang der Eisenbahnlinie wollen die Beteiligten die Verlegung von Stromkabeln und digitalen Verbindungen sowie von Rohrleitungen für den Export von »sauberem« Wasserstoff ermöglichen. Der Korridor werde die Effizienz steigern, die Kosten verringern, »die wirtschaftliche Einheit fördern«, Arbeitsplätze schaffen und zu niedrigeren Emissionen von Treibhausgas führen, heißt es weiter in der gemeinsamen Absichtserklärung.
Konkrete Angaben fehlen in diesem MoU vollständig. Man erfährt nichts über den künftigen Verlauf der Bahnstrecke zwischen der Arabischen Halbinsel und Israel. Von einem Zeitrahmen für die Umsetzung des Projekts ist ebensowenig die Rede wie von den voraussichtlichen Kosten oder einer seriösen Berechnung des erhofften Nutzens. Auch die Frage, welche Staaten und Privatunternehmen zu den erforderlichen umfangreichen Investitionen bereit sein könnten, ist völlig offen. Aus all diesen Defiziten lässt sich schließen, dass das Projekt sich höchstens im ersten Stadium der Planung befindet. Die Beteiligten wollen sich innerhalb der nächsten 60 Tage treffen, um über einen »Aktionsplan mit diesbezüglichen Zeittafeln« zu diskutieren, heißt es im MoU.
Nicht einmal die einzige relevante Zahl, die in diesem Zusammenhang von der Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, genannt wird, ist sachlich begründet: Der geplante »Korridor« werde den Frachtverkehr zwischen Indien und Europa um 40 Prozent schneller machen, behauptete sie am 9. September in Neu-Delhi. Wissenschaftlich errechnet ist das gewiss nicht, zumal der Verlauf der geplanten Bahnstrecke noch nicht festgelegt ist und die Zeitdauer des Frachtverkehrs von und nach Indien für verschiedene Regionen Europas ungleich ist. Für Indiens wichtigste Handelspartner würde sich durch den »Korridor« nichts ändern. An erster Stelle stehen laut Trading Economics die USA, die 18 Prozent der indischen Exporte aufnehmen, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien (zusammen 9,3 Prozent der Exporte) und China (3,4 Prozent).
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Präsentation des IMEC während des G20-Gipfels als Propaganda- und Wahlkampfshow für Joseph Biden dar, dem die Gastgeber die Vorstellungsrede überließen, obwohl die finanzielle und politische Rolle der USA bei einer eventuellen Umsetzung des Plans anscheinend ungeklärt ist. Der US-Präsident, der für das höchstens auf dem Papier stehende Projekt nichts Erkennbares getan hat, erwähnte seinen »Stolz, heute dieses historische Abkommen zu verkünden«, und sprach gleich zweimal hintereinander den Satz: »This is a big deal.«
Westliche Medien feierten den Vorgang pflichtbewusst als gelungenen und ziemlich genialen Schlag der Biden-Regierung gegen Chinas »Neue Seidenstraße«, die meist auf englisch als »Belt and Road Initiative« (BRI) bezeichnet wird. Der US-Sender CNN sprach von einer »Herausforderung für Chinas Ambitionen«. Der Spiegel phantasierte dreist vereinnahmend: »Doch hinter den Kulissen nutzen die Amerikaner die Chance – und schmieden ein mächtiges Bündnis gegen Peking«. Überschrift: »Wie die USA den Rivalen China an den Rand drängen«. Offensichtlich haben die Macher des Magazins eine geringe Meinung von der Sachkenntnis und Intelligenz ihres Publikums.
Das Außenministerium in Beijing demonstrierte angesichts des plump-aufdringlichen Theaters Gelassenheit: China begrüße alle Initiativen, die wirklich dazu verhelfen, die Infrastruktur der sich entwickelnden Länder auszubauen. »Gleichzeitig treten wir dafür ein, dass die verschiedenen Initiativen zur Vernetzung offen, inklusiv und und auf Synergie ausgelegt sind, und dass sie nicht zu geopolitischen Instrumenten werden.«
Deutlicher fiel die Kritik in der englischsprachigen chinesischen Tageszeitung Global Times aus: Angesichts früherer Lippenbekenntnisse der USA frage man sich allgemein, »ob dies nicht ein neues amerikanisches Influencerprojekt ist, das darauf abzielt, gewisse Länder ›einzuwickeln‹«. Die reale wirtschaftliche Bedeutung des IMEC sei gering, da die EU mit Indien nur etwa zwei Prozent ihres Außenhandels abwickle.
Hintergrund: Wirtschaftskorridor
Der Frachtverkehr zwischen Indien und Europa findet gegenwärtig hauptsächlich per Schiff durch den Suezkanal statt. Das Projekt eines neuen »Wirtschaftskorridors« sieht statt dessen, wenigstens auf dem Papier, den Seeweg von Indien zur arabischen Halbinsel und weiter per Bahn über Jordanien nach Israel vor. Das ist zweifellos kürzer und auch schneller. Ob es aber auch billiger würde, wie die EU behauptet, ist eine offene Frage. Neben den voraussehbar hohen Investitionskosten ist auch zu berücksichtigen, dass alle Frachtgüter zweimal zusätzlich umgeladen werden müssten: zuerst in einem Hafen der arabischen Halbinsel vom Schiff auf die Bahn und dann wieder in Israel, vermutlich in Haifa, von der Bahn aufs Schiff.
Unabhängig von diesem ambitionierten Projekt, dessen sämtliche Details erst noch festgelegt werden müssten, ist die »Gulf Railway« ein mindestens seit 2009 geplantes Vorhaben, das während der letzten Jahre nach mehrfachen Verzögerungen und Unterbrechungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Saudi-Arabien zu erheblichen Teilen umgesetzt wurde, während die anderen Beteiligten mehr oder weniger hinterherhinken. Das Ziel besteht darin, die wichtigsten Städte der sechs Mitgliedstaaten des Golfkooperationsrates, also aller Länder der arabischen Halbinsel mit Ausnahme Jemens, durch Bahnlinien stärker miteinander zu verbinden. Ausgegangen wurde von einem Schienennetz von mehr als 2.100 Kilometer Länge und Baukosten in Höhe von mehr als 200 Milliarden US-Dollar.
Die gegenwärtig schon vorhandenen Bahnstrecken sind aber selbstverständlich nicht darauf ausgerichtet, zusätzliche große Gütermengen nach Jordanien und von dort aus weiter nach Israel zu transportieren. Noch steht nicht einmal fest, in welchem Hafen oder welchen Häfen die Frachtgüter aus Indien von Schiff auf die Bahn umgeladen werden sollen. (km)
Seite 4 von 17