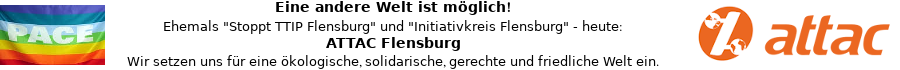Die Welt war fair, bevor der Russe losschlug: Das ist das Weltbild des deutschen Buchhandels – gemessen an den Friedenspreisen seit 2022. Warum jemand ausgezeichnet werden sollte, der uns den Imperialismus erklärt. Und wer das sein könnte
Von Oliver Schlaudt,Daniel Burnfin, Velten Schäfer
Er sei ein „hochklassiger Muskelprotz für das Big Business“ gewesen, „für die Wall Street und die Banker, (…) ein Gangster, ein Verbrecher für den Kapitalismus“. Harte Worte, und es geht weiter: „Man hat unseren Jungs, die in den Tod geschickt wurden, schöne Ideale vorgegaukelt (…). Niemand hat ihnen gesagt, dass es in Wirklichkeit um Dollars und Cents ging.“
Ähnliches könnte wohl jeder Soldat über fast jeden Krieg sagen. Aber Smedley Butler, aus dessen 1935 erschienenem Manifest War is a Racket diese Sätze stammen, war nicht irgendein Soldat. Und die Kriege, in denen er kämpfte, sind zwar vergessen, waren aber trotzdem nicht irgendwelche Kriege. Butler ist bis heute der einzige Soldat der US-Streitkräfte, der zweimal mit der höchsten Auszeichnung dekoriert wurde, der Medal of Honor. Die Einsätze, in denen er sich diese verdiente, markieren den Anfang einer Ära und eines Systems, das bis heute so fest im Sattel sitzt, dass es viele gar nicht mehr als solches erkennen: des Imperialismus à la USA.
Als Butler seine Orden verdiente, war das in einer Hinsicht ähnlich: Die Operationen, in denen sich der Marine-Infantrist auszeichnete – die Besetzung des mexikanischen Hafens Veracruz 1914 und der Überfall auf Haiti 1915, dem zwanzig brutale Besatzungsjahre folgen –, zeigten zwar aller Welt, dass hier eine neue Macht aufstieg, die nicht zögerte, ihre Macht- und Wirtschaftsinteressen mit Kanonenbooten durchzusetzen. Doch die alten Imperien Europas, die sich gerade zu zerfleischen begonnen hatten, brauchten noch Jahre, um zu verstehen, dass sie ausgespielt hatten, die Besiegten wie die Sieger.
Karl Schlögel nimmt Putin ins Visier
Und heute? Ist dieser „Imperialismus“ allenfalls Schnee von vorgestern. Das behauptet zumindest die amerikanische Historikerin Anne Applebaum. In ihrem Buch Die Achse der Autokraten wischt sie nicht nur über hundert Jahre revolutionärer, linker oder auch nur humanistisch-liberaler Imperialismuskritik vom Tisch, sondern gleich den ganzen Begriff.
So etwas wie eine systematische, herrschafts- und nötigenfalls auch gewaltförmige Asymmetrie im Weltsystem gibt es ihr zufolge gar nicht, nur einen Kampf von Gut gegen Böse. Andere prominente Stimmen kennen zwar noch den Begriff, entkleiden ihn aber jeder systemischen Ebene: „Imperialismus“ ist dann nur noch eine negative Charaktereigenschaft von politischen Führern oder gleich ganzen „Kulturen“.
Man ahnt, wer gemeint ist: „Die Russen sind Barbaren, sie sind gekommen, um unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Bildung zu vernichten“, charakterisiert der ukrainische Dichter Serhij Zhadan in Himmel über Charkiw die „imperiale Kultur“ Russlands. Der Historiker Karl Schlögel nimmt jüngst eher den Präsidenten persönlich ins Visier: „Getrieben und überwältigt von Hass“ sei dieser, „gepeinigt von einer Kränkung und einem Komplex“, der aus ihm herausbreche: „Die unbewältigte Geschichte des untergegangenen Imperiums, dessen (…) Wiedererrichtung als Drittes Imperium er (...) betreibt“ – so schreibt er in einem Sammelband, der Wladimir Putin in eine Reihe von „Tyrannen“ von Nero über Ivan den Schrecklichen bis Augusto Pinochet stellt.
Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht an Kriegsideologen
Zhadan, Applebaum und Schlögel haben nun eins gemeinsam: Sie sind in dieser Reihenfolge Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in den Jahren 2022 bis 2025. Bemerkenswert ist daran nicht nur, dass diese Auszeichnung, die früher gern Persönlichkeiten verliehen wurde, die für Versöhnung, Dialog und Deeskalation standen, zum dritten Mal in Folge an Verfechter einer maximalistischen Kriegsagenda geht. Nimmt man diesen Preis als das, was er sein will – das jährliche Statement der deutschen Geisteswelt zur politischen Lage des Planeten –, stimmt es bedenklich, wie naiv wir Dichter und Denker in eine Zukunft zu stolpern scheinen, die womöglich von tiefgreifenden Umbrüchen im Weltsystem geprägt sein wird.
Schon deshalb ist es geboten, den Imperialismus als Systembegriff wieder freizulegen. Das ist aber kaum möglich, ohne die führende Macht zu benennen, die das entsprechende Instrumentarium geschaffen hat. Diese Macht sind – allen möglichen Verschiebungen in näherer Zukunft zum Trotz – bis heute die Vereinigten Staaten von Amerika, die mit 750 Militärbasen in 80 Staaten präsent sind und ihre Währung als globale Leitwährung installiert haben.
Dass das mitunter in Vergessenheit zu geraten scheint, liegt auch daran, dass die USA sich bei der Erlangung und Verteidigung ihrer globalen Dominanzposition als höchst flexibel und kreativ erwiesen haben. In Washington wurde der Imperialismus sozusagen mehrfach neu erfunden – bis hin zu einem Punkt, an dem er in den Augen vieler schlicht unsichtbar wurde.
Die erste dieser Überraschungen war nach dem Ersten Weltkrieg in London und Paris zu verdauen: Nachdem die USA – durch genau die Art von protektionistischer Wirtschaftspolitik, die sie bis heute anderen Ländern zu untersagen versuchen – eine rasante Industrialisierung durchlaufen und mehr noch als durch direkte Kampfeinsätze durch ihre Waffenlieferungen den Abnutzungskrieg in Europa entschieden hatten, wurde nun ungerührt die Rechnung präsentiert: Die ab 1917 gelieferten Kriegsmittel seien selbstverständlich zu bezahlen! Die kriegserschöpften Siegermächte Frankreich und England saßen also plötzlich auf astronomischen Verbindlichkeiten. Den besiegten Feind Deutschland behandelte Washington hingegen eher rücksichtsvoll – wohl um es als Gegenspieler von England benutzen zu können und Letzteres noch mehr zu schwächen.
Die USA hätscheln den offiziellen Feind und demütigen ihre Verbündeten. Der zu Selbstbewusstsein erwachte Adler „spreizte seine Klauen“, wie es Michael Hudson 1972 in seinem noch immer lesenswerten Buch 'Super Imperialism' beschrieb. Mit „Super-Imperialismus“ meinte er ein präzise definiertes Phänomen. Anders als im klassischen europäischen Imperialismus, der in diesen Weltkrieg geführt hatte, ist es nicht mehr das private Kapital, das den Staat dazu drängt, ihm gewaltsam neue Märkte zu öffnen. Im Gegenteil agierte die amerikanische Regierung hier mit ihren eigenen finanziellen Mitteln und konsolidierte die Vorherrschaft der USA, indem sie Konkurrenten in die Position von Schuldnern bringt.
Im 20. Jahrhundert nahm diese Geschichte viele Wendungen, die den kaltblütigen Pragmatismus amerikanischer Regierungen zeigen. Der Zweite Weltkrieg spülte Unmengen Gold in die USA. 60 bis 65 Prozent der globalen Goldreserven lagen 1945 in ihren Tresoren. Die USA nutzten diesen Hebel: Mit dem Abkommen von Bretton Woods wurde der Dollar an das Gold gekoppelt und somit zur globalen Leitwährung. Zugleich entwarfen die USA mit den Institutionen des Internationalen Währungsfonds (IWF), der Weltbank und des General Agreements on Tariffs and Trade die globale Finanz- und Wirtschaftsarchitektur, die in der Nachkriegszeit den weltweiten Freihandel voranbringen sollte.
60 bis 65 Prozent der globalen Goldreserven lagen 1945 in den Tresoren Federal Reserve
Auch wenn die USA – rund 400 Militärinterventionen zwischen 1776 und 2023 zeugen davon – auf eine Kanonenbootpolitik wie zu Smedley Butlers besten Zeiten nie verzichtet haben, ist dies eine ganz neue Art von Dominanz. Die Vereinigten Staaten beginnen, ihre Vorherrschaft hinter einem vordergründig allgemeingültigen und neutralen Regelwerk zu verstecken. Dessen Herrschaftsförmigkeit zeigt sich freilich darin, dass die USA niemals vorhatten, sich selbst an irgendeine dieser neuen Regeln zu halten. In IWF und Weltbank haben sie eine Sperrminorität. Das Freihandelsabkommen GATT – 1996 von der Welthandelsorganisation WTO abgelöst – trieb Washington zwar maßgeblich voran, ratifizierte es selbst aber nie. Handelspartner sind so zum Freihandel gezwungen, während die USA sich jederzeit Marktschließungen vorbehalten.
Wie schwer es den „Partnern“ fiel, dieses System zu verstehen, zeigte sich 1971 in spektakulärer Weise. Plötzlich kündigten die USA das Bretton-Woods-Abkommen de facto. Die teure globale Militärpräsenz – besonders die Kriege in Korea und Vietnam – hatte die Vereinigten Staaten vom internationalen Gläubiger in einen internationalen Schuldner verwandelt. Also entschied Präsident Richard Nixon, jene Konvertibilität des Dollars in Gold abzuschaffen, die die Grundlage für die ökonomische Nachkriegsarchitektur gewesen war.
Die Vereinigten Staaten beginnen, ihre Vorherrschaft hinter einem vordergründig allgemeingültigen und neutralen Regelwerk zu verstecken.
Wie wenig etwa die bundesrepublikanische vox populi diese Wendung begriff, zeigte eine Karikatur in der Süddeutschen Zeitung, die einen ökonomischen Selbstmord der USA suggerierte. Als etwas klüger erwies sich der prominente Journalist Diether Stolze – später Helmut Kohls Wirtschaftsberater – in der Zeit. Zwar sah auch er eine Panikreaktion, aber er beobachtete korrekt: „Nixon möchte nicht mehr die Amerikaner für die Stabilisierung bezahlen lassen, sondern das Ausland.“
Tatsächlich verlagerte die Schließung des Goldfensters das Risiko der Dollarabwertung auf ausländische Zentralbanken, die große Dollarreserven hielten, aber nun keinen Anspruch mehr auf amerikanisches Gold erheben konnten. Was sich aber auch Stolze nicht vorstellen konnte, war, dass diese Politik den USA mehr als nur eine Atempause verschaffen könnte. Tatsächlich aber hatte Washington entdeckt, dass sich die Welt genauso gut als globaler Schuldner kontrollieren ließ wie zuvor als globaler Gläubiger. Die USA bezahlten ihre Militärpräsenz und damit ihre Machtbasis nunmehr mit Papiergeld, das die ausländischen Regierungen wohl oder übel annehmen mussten, um ihre eigenen Dollarreserven nicht zu entwerten. So übernahm die Welt die Kosten dafür, sich von den USA beherrschen zu lassen.
Die USA bezahlten ihre Militärpräsenz und damit ihre Machtbasis nunmehr mit Papiergeld
Hier kehrt sich also, wie schon Michael Hudson erläutert, die Funktionsweise des klassischen Imperialismus um, wobei das Ergebnis dasselbe bleibt: die Gewinnung von Ressourcen in Form von Renten aus dem Rest der Welt durch finanzielle Mittel und mit militärischer Unterstützung. Ziel der USA ist nun nicht mehr, anderen ihre Exporte aufzudrücken, also überschüssige Rohstoffe, Güter und Kapital. Vielmehr versuchen sie heute, als der größte Nettoimporteur, den Rest der Welt als Nettoexporteure dazu zu bringen, Zahlungen für reale Güter in einer Währung zu akzeptieren, die durch nichts gedeckt ist.
Damit bleibt allen anderen nur eine Option: der Kauf amerikanischer Aktien und Staatsanleihen, sprich Schuldscheine für noch mehr Dollar. Die imperialistische Maschine läuft nun bilanztechnisch umgekehrt, aber mit umso größerer Wirkung: Die Vermögensbesitzer in den USA eignen sich den Reichtum der Welt an, die dafür nichts bekommt als Papier und Zahlen in einer Bilanz. Es zahlt sich für die USA wirklich aus, die Welt mit ihrer globalen Reservewährung und 750 Militärstützpunkten auf der ganzen Welt zu dominieren.
Das war ein Geniestreich – mit günstigen Nebenwirkungen. Denn auch viele Kritiker der USA verstehen nicht, dass für diese nun ganz eigene Regeln gelten. Ständige Abgesänge auf die „hochverschuldeten“ USA, die demnächst als Weltführungsmacht abdanken müssten, sind nicht nur Wunschdenken, sondern tragen auf ihre Weise zu einer Dethematisierung der amerikanischen Weltdominanz bei.
Trumps Zollpolitik steht in einer Tradition
Wider Willen ergänzt sich hier eine begriffslose Kritik mit der vollkommen naiven Weltsicht, die dergestalt beschaffene „regelbasierte Weltordnung“ sei eine zivilisatorische Errungenschaft der „Weltgemeinschaft“ – sowie mit einem Vasallenstolz, der die nachgeordnete Mitwirkung in diesem System als Privileg und moralische Verpflichtung verstehen will.
Und geradezu als Booster der Normalisierung und Moralisierung dieses funktional invertierten, aber höchst effektiven Imperialismus wirkt nunmehr die landläufige Verdammung Donald Trumps: Indem etwa seine Zoll-Erpressungspolitik geradezu als zivilisatorischer Bruch bejammert wird, erscheint der vorhergegangene Zustand systematischer herrschaftsförmiger Asymmetrie als die gute alte Zeit. Dabei zieht Trump nur einen Pfeil aus dem Köcher, den sich die USA stets aufgehoben hatten: Wenn beiderseitiger Freihandel uns einmal nicht nützlich erscheint, können wir jederzeit auf Einbahnstraße umschalten!
Damit haben wir ein Modell dafür, was wir heute unter Imperialismus verstehen müssen: Imperialistisch ist ein Land, das seine Interessen kennt und so konsequent wie rücksichtslos verfolgt. Es betrachtet andere grundsätzlich nicht als gleichberechtigte Partner, sondern immer nur als Hebel des eigenen Vorteils. So etabliert es eine globale Hegemonie, die nicht nur politisch den Ton angibt, sondern sich auch den größten Teil des globalen Reichtums sichert, während es die Kosten der Herrschaft auf die Beherrschten abwälzt.
Niemand außer den USA kommt auch nur in die Nähe einer solchen imperialistischen Machtfülle – natürlich auch Russland nicht, selbst wenn Putin wirklich davon träumen sollte. Für den Bestand dieser Macht ist es auch zweitrangig, ob der 2008 verkündete Plan, die NATO bis an die russische Grenze auszudehnen, in den Gräben des furchtbaren – wenn auch nicht „genozidalen“ – Ukraine-Krieges steckenbleibt. Die derzeitige „Lösung“, in der sich Westeuropa und Russland gegenseitig schwächen, während die Ukraine blutet und die USA kassieren, erinnert nicht zufällig an die US-Politik nach dem Ersten Weltkrieg.
Damit haben wir ein Modell dafür, was wir heute unter Imperialismus verstehen müssen: Imperialistisch ist ein Land, das seine Interessen kennt und so konsequent wie rücksichtslos verfolgt.
So ist es verfrüht, wenn etwa Marc Saxer von der Friedrich-Ebert-Stiftung anlässlich amerikanischer Absetzbewegungen von der Ukraine im IPG-Journal resümiert, „der Hegemon“ habe „die von ihm geschaffene und über Jahrzehnte garantierte liberale Weltordnung für obsolet erklärt“. Tatsächlich ist die US-Dominanz alive and kicking, wie man in den Staaten sagt. Nervös machen würde Washington etwas anderes: Wenn die sogenannten BRICS-Staaten die Mittel gewännen, ihre bislang utopische Drohung mit einer zum US-Dollar alternativen Leitwährung umzusetzen.
Und zweitens zeigt die verharmlosende Rede von einer „liberalen Weltordnung“, der nunmehr eine „Wolfsgesellschaft“ zu folgen drohe, wie dringend eine kritische Öffentlichkeit eines erneuerten Imperialismusbegriffs bedarf. Denn die Ordnung, die wir hier hauptsächlich in ihrer polit-ökonomischen Funktionsweise zu skizzieren versuchten, ist ja wolfsmäßig genug.
Blickt man über die Kernstaaten des „Westens“ hinaus, ist von einer Pax Americana kaum eine Spur. Es zeigt sich eine lange Reihe an Kriegen und „Interventionen“, an bewaffneten Auseinandersetzungen, die nur im Spannungsfeld des imperialistischen Verhältnisses zu verstehen sind, und viel strukturelle Gewalt – von wirtschaftlichem Zwang über politische Entrechtung bis zu Armut und Hunger.
Der Fall Venezuela zeigt, wie schwer es ist, sich dem Imperium zu entziehen
So muss man dem Nobel-Komitee dieser Tage ironisch danken für die Vergabe seines „Friedenspreises“ an die venezolanische Politikerin María Corina Machado. Ja, die Partei der politischen und ökonomischen Hardlinerin wurde 2024 wohl um einen Wahlsieg gebracht. Machado war aber 2002 auch am Putsch gegen den gewählten Präsidenten Hugo Chávez beteiligt und drängte 2019 auf eine außerkonstitutionelle Absetzung von Nicolás Maduro.
Nun hat sie die Auszeichnung umgehend Trump gewidmet, der zugleich vor der Küste „Drogenboote“ versenkt und Kanonenboote versammelt. Der Fall Venezuela zeigt, wie schwer es ist, sich dem Imperium zu entziehen: Dieses kann jederzeit ein solches Maß an wirtschaftlichem und politischem Druck aufbauen – erst von außen, dann von innen –, dass isolierte Ausbruchsversuche tatsächlich oft im Griff zu repressiven Mitteln enden. Wäre etwa Burkina Faso strategisch wichtiger, stünde Präsident Ibrahim Traoré längst im Fokus.
Es gibt einen bösen Satz von Henry Kissinger, dem Doyen der US-Weltdominanz: „Amerika hat keine Freunde, es hat Interessen. (...) Ein Feind der USA zu sein, ist gefährlich, ein Freund zu sein, ist tödlich.“ Geht es weiter wie zuletzt, könnten wir bald erleben, was das bedeutet. Durch seine aggressive Exportorientierung nahm Deutschland im beschriebenen Post-Bretton-Woods-System eine Sonderposition ein. Unter den europäischen Vasallen war es der Primus und konnte einen guten Teil der Tribute nach unten durchreichen, etwa in Form von nach Südeuropa exportierter Arbeitslosigkeit. Doch damit scheint nun Schluss zu sein, nicht zuletzt durch den Wegfall billigen Erdgases.
Zwei Dinge sind wichtig, um dieses böse Erwachen angemessen zu verarbeiten: Putin trifft ausnahmesweise keine Schuld – und Imperialismus ist doch etwas mehr als jene Diktatoren-Propaganda, von der Anne Applebaum spricht. Sollte der deutsche Buchhandel für seinen Friedens-Schild einmal jemanden suchen, der all das erklären kann, steht ein Kandidat längst bereit: Jener Michael Hudson, von dem hier mehrfach die Rede war. Sein einschlägiges Werk zum Super-Imperialismus müsste freilich zunächst übersetzt werden. Freiwillige vor – es lohnt auch ohne Friedenspreis!
Oliver Schlaudt lehrt Philosophie und Politische Ökonomie an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz. Daniel Burnfin lehrt Germanic Studies an der University of Chicago. Velten Schäfer ist Redakteur des Freitag