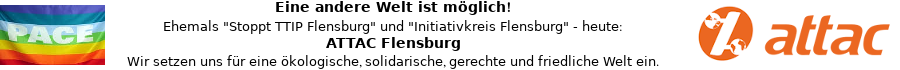Vergleich von SARS und COVID-19
Die Erstsymptome von SARS waren Fieber (100%), Husten (61,8%), Muskelschmerzen (48,7%), Atemnot (40,8%) und Durchfall (31,6%).
Bei im Krankenhaus betreuten Fällen trat in 90,8% der Fälle Atemnot auf.
Die Atemnot trat im Durchschnitt 9,8 (±3,0) Tage nach den ersten Krankheitssymptomen auf.
Während des Krankheitsverlaufes entwickelten einige Patienten Leukopenie, Lymphopenie und Thrombopenie.
Die Inkubationszeit (Zeitdauer von der Infektion bis zum Krankheitsausbruch mit ersten Symptomen) von COVID-19 ist mit 3-7 Tagen (max. 14 Tage) etwas länger als die von SARS mit 1-4 Tagen (selten über 10 Tage).
Bei COVID-19 sind die wichtigsten Manifestationen Fieber, Ermüdung und trockener Husten, während verstopfte oder laufende Nasen und andere Symptome der oberen Atemwege seltener sind.
Der typische Krankheitsverlauf ist eine progressive Verschlechterung, wobei
- milde Fälle (keine Atembeschwerden),
- normale Fälle (Fieber, Atembeschwerden),
- schwere Fälle (Atemnot, Atemfrequenz ≥ 30/min, partielle arterielle Sauerstoffsättigung ≤ 300mmHg) und
- kritische Fälle (Lungenversagen, Schock, damit verbundenes Versagen anderer Organe, die eine Intensivbetreuung notwendig machen)
unterschieden werden.
Auffallend ist, dass viele Patienten sich subjektiv noch relativ fit fühlen, während sie schon bedenklich niedrige Blutsauerstoffwerte und hohe Atemfrequenzen zeigen und der Intensivbehandlung bedürfen.
Dies scheint eine Folge der ungewöhnlichen Ausprägung der Symptomatik in der Lunge zu sein, bei der nur Teile des Gewebes Wasser einlagern und dadurch verhärten (und weniger Sauerstoff aufnehmen können), während andere Teile zwar schlecht durchblutet werden, aber elastisch bleiben – dadurch entsteht erst spät das subjektive Gefühl der Atemnot.
80% der Fälle verlaufen leicht (mild bis normal), 16% schwer und etwa 6% kritisch – allerdings schwanken die Zahlen je nach betrachteter Population.
In einem untersuchten Fall einer abgeschlossenen Population (auf einem Kriegsschiff) blieben zwei Drittel der Infizierten ohne Symptome.
Offenbar verbleiben die Viren bei einem großen Teil der Infizierten im Mund-Rachen-Raum und rufen dort (wenn überhaupt) nur geringe Symptome wie Halskratzen hervor.
Wenn die Viren jedoch die Lunge befallen, folgt fast immer schwerer Krankheitsverlauf, der auch junge und anderweitig gesunde Patienten stark belastet und eventuell auch (zumindest mittelfristige) Folgeschäden wie Lungenschmerzen bei sportlicher Belastung nach sich ziehen kann.
Die Sterberate ist derzeit nur sehr schwer einzuschätzen, da die realen Infektionszahlen mangels flächendeckender Tests nicht einmal annähernd bekannt sind.
Die aktuelle (18. April 2020) Sterberate als Verhältnis von gemeldeten Fällen (positiv getesteten Infizierten, diese fast immer mit Symptomen) und Verstorbenen liegt zwischen 2,2% in Südkorea und 13,4% in Großbritannien.
Weltweit sind es – nach den Zahlen der Johns-Hopkins-Universität – 6,9%; Deutschland 3,1%, USA 5,2% (New York City 5,6%), China 5,5%, Brasilien 6,3%, Spanien 10,5%, Niederlande 11,4%, Frankreich 12,5%, Italien13,2%.
Allerdings gehen Schätzungen von einer starken Untererfassung der Infizierten aus.
Die Zahlen schwanken dabei zwischen 5% und knapp 10% der Erfassung, d.h. die Zahlen der tatsächlich Infizierten (und auch der nach überstandener Infektion Immunisierten) könnten um den Faktor 10 bis 20 höher als die offiziellen Angaben sein sowie die Letalität entsprechend niedriger.
Die Heinsberg-Studie ermittelte einen Letalitätswert von 0,37% – dies läge in der Größenordnung der Wintergrippe 2017 mit einer Letalität von knapp 0,3% (bei geschätzten 9 Millionen Infizierten und 25.100 Toten).
Die Mehrzahl der Erkrankungen (also Infektion mit Krankheitssymptomen) betrifft ältere Patienten, unter 20-Jährige sind kaum betroffen, jedoch sind schwere Fälle bei jungen Patienten dokumentiert, die bestimmte Vorerkrankungen haben, besonders chronische Krankheiten wie Diabetes und Hepatitis B.
Ebenfalls gefährdet sind Personen unter Langzeitbehandlungen von Hormonen oder Immunsuppressiva mit verringerter Immunabwehr.
Die sogenannte Risikogruppe wird von multimorbiden Patienten mit Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Raucherlunge, Krebs, Adipositas etc. gebildet, wobei das Alter den signifikanten Faktor für die Sterbewahrscheinlichkeit bildet.
Derzeit wird über die Risiken einer (vorschnellen) Beatmung durch Intubation bei Vollnarkose diskutiert, da bis zu 80% der so behandelten Intensivpatienten versterben.
Unabhängig von diesen Behandlungsrisiken wird empfohlen, bei älteren multimorbiden Patienten mit diesen oder ihren Angehörigen über Alternativen zu sprechen (sowie Patientenverfügungen zu beachten) und eine Palliativbehandlung zumindest in Erwägung zu ziehen.
Die letztendliche Todesursache lässt sich bei Verstorbenen mit einer SARS-CoV-2-Infektion nur durch eine Obduktion feststellen, die zurzeit nur in wenigen Fällen durchgeführt wird, daher sind auch die Angaben zur absoluten Anzahl von COVID-19-Todesfällen fraglich.
Herkunft des Virus
Es ist bekannt, dass Fledermäuse als Wirte von mehr als 30 Coronaviren auftreten.
2010 konnte in der Chinesischen Hufeisennase ein Virus nachgewiesen werden, dessen Genom eine große Ähnlichkeit mit SARS-CoV[-1] aufweist, als Zwischenwirt zum Menschen traten vermutlich Schleichkatzen auf, die in unmittelbarer Nähe von Menschen gehalten wurden.
Das neuaufgetretene SARS-CoV-2 teilt mit SARS-CoV[-1] über 80% des Genoms; aus der Java-Hufeisennase wurde ein Coronavirus mit 96,2%-iger Genomähnlichkeit isoliert und diese damit als Quelle des neuen Virus wahrscheinlich gemacht.
Die Übertragung des neuen Virus fand wahrscheinlich durch Schuppentiere – in Asien als Pangolin bezeichnet – statt, deren Fleisch als Delikatesse gilt und deren (Keratin-)Schuppen in der traditionellen Medizin Verwendung finden.
Studien zeigten, dass etwa 70% aller Pangoline Coronaviren in sich tragen.
Ein kürzlich isoliertes Virus zeigt eine hohe Übereinstimmung der RNA-Sequenz mit SARS-CoV-2, so dass Schuppentiere zumindest als einer der Überträger sehr wahrscheinlich sind.
Um neuerliche Erstübertragungen von Wildtieren zu verhindern, sind in den Herkunftsgebieten die Jagd, der Handel und der Verzehr von Wildtieren zu unterlassen.
Dazu muss jedoch hinzugefügt werden, dass die meisten Zooanthroponosen (vom Tier auf den Menschen übertragene Krankheiten) nicht von exotischen Tieren, sondern von Nutztieren in Massenhaltung, ganz besonders dem Schwein, herrühren.
Das humane SARS-CoV-2 kann offenbar auch wieder vom Menschen auf Tiere übertragen werden: bei einigen Zootieren wurde eine Infektion mit entsprechender Symptomatik festgestellt und auch Haustiere, wie Hunde und besonders Katzen, können sich infizieren, aber wohl nicht als Überträger fungieren.
Prävention, Diagnose, Behandlung
Prävention
Da die Übertragung durch Tröpfchen und direkten Kontakt erfolgt, ist allgemeine Kontakteinschränkung, frühzeitige Erkennung und Isolierung von Infizierten sowie Überwachung stark frequentierter Plätze und Räume notwendig.
Bei direktem Kontakt zu Infizierten, z.B. durch Pflegepersonal, sollte mindestens eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) der niedrigsten Sicherheitsstufe (international: Level D) getragen werden.
Im gesamten öffentlichen Raum und im Arbeitsumfeld (d.h. außerhalb der privaten Wohnräume) ist als effektivste und einzig sichere Prävention auf einen Abstand zu anderen Personen von mindestens eineinhalb Metern zu achten.
Zusätzlich sollte man sich bei heftigem Ausstoß von Atemluft, z.B. Husten, Niesen, schwerem Atmen (beim Joggen, Radfahren etc.), aber auch lautem Singen, welches größere Aerosolwolken erzeugt, von anderen Personen abwenden.
Die »Einfallstore« für das Virus in den menschlichen Organismus sind die Gesichtsschleimhäute, d. h. die Schleimhäute von Nase, Mund und auch der Augen(!) – es ist also wichtig, mit den Händen nicht in die Nähe des Gesichts zu kommen.
Das Tragen von einfachem Mund-Nase-Schutz (MNS, »Alltagsmaske« inkl. einfacher Mund-Nase-Bedeckung, z. B. durch Schals) ist kein Ersatz für das Abstandhalten und kein geeigneter Schutz in Situationen, die einen geringeren Abstand erzwingen (wie in öffentlichen Verkehrsmitteln).
Die zurzeit stark diskutierte und zum Teil schon umgesetzte Pflicht zum Tragen von einfachem Mund-Nase-Schutz(-Masken) wird nicht nur von den Experten des Robert-Koch-Institutes (RKI) äußerst kritisch gesehen.
Es sind hierbei folgende Aspekte zu beachten:
1. Ein MNS schützt weder vor einer eigenen Ansteckung mit SARS-CoV-2 noch ist er ein sicheres Mittel, andere Personen vor einer Ansteckung durch eine eigene Infektion zu bewahren.
Tragen infizierte Personen MNS, so wird die Verbreitung von Tröpfchen in der Atemluft als potenziellen Virenträgern zwar vermindert, jedoch dringen Mikroaerosole durch die meisten verwendeten Gewebe ungehindert hindurch.
2. Das Tragen des ungewohnten Schutzes verleitet die meisten Personen zu einem mehr oder weniger häufigen »Zurechtrücken« des Schutzes, dabei gelangen (besonders durch den häufig zu beobachtenden einhändigen Griff in Höhe der Nasenwurzel) die Hände ins Gesicht und in die Nähe der Augen. Das gleiche gilt für das An- und Ausziehen des Schutzes in der Öffentlichkeit (zu Verhaltenstipps siehe das Fazit).
3. Es wird von verschiedenen Seiten argumentiert, dass eine Mundschutzpflicht ein wesentlicher Faktor bei der Eindämmung der Epidemien in asiatischen Ländern wie China und Südkorea gewesen sei – dafür gibt es jedoch keine hinreichenden Daten.
Die Eindämmung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 war dort das Ergebnis äußerst strikter Maßnahmen zur Distanzwahrung oder sogar vollständigen Isolation, großflächiger Desinfektion ganzer Gebäude und Straßenzüge, lückenloser Verfolgung der Infektionsketten (besonders in Südkorea), Massentests und individueller Bewegungsverfolgung durch Smartphones.
Ob das Tragen von Gesichtsmasken (ursprünglich auch als Schutz vor Luftverunreinigungen in Asien auch vor der Pandemie weit verbreitet) dabei unterstützend, neutral oder negativ (siehe oben) gewirkt hat, ist durch fehlende Vergleichsdaten zurzeit völlig ungewiss.
Das aktuelle Beispiel der Stadt Jena, die am 2. April eine »Maskenpflicht« eingeführt hat und ab dem 10. April keine Neuinfektion meldet, ist aufgrund der ohnehin geringen Fallzahlen (155 nachgewiesene Infektionen insgesamt) und der vorher getroffenen Maßnahmen nicht aussagekräftig.
4. Das Tragen von MNS könnte zudem zur Vernachlässigung der Distanzwahrung als einzig wirksamer Maßnahme beitragen.
Die vermehrten Forderungen nach einer Mundschutzpflicht gehen regelmäßig mit der Annahme einher, dass eine solche Teil einer »Exitstrategie« inklusive einer Lockerung der Abstandregelungen sein könne – dies ist nach aktuellen Erkenntnissen jedoch eine unhaltbare und gefährliche Strategie.
Diagnose
Die frühen Symptome von SARS und COVID-19 sind denen der Wintergrippe sehr ähnlich,
und der wichtigste Weg zur Unterscheidung von Influenza und Lungenentzündung ist ein Rachen- und Nasenabstrich für einen Virustest.
Die momentan angewandten, sicheren Nachweismethoden beruhen allesamt auf PCR (Polymerase-Kettenreaktion) und nehmen einige Stunden in Anspruch. Meist wird der Test zweistufig durchgeführt, d.h. zuerst wird eine Virusinfektion durch unspezifische Primer bestätigt, dann SARS-CoV-2 durch spezifische Primer nachgewiesen.
Sogenannte Schnelltests suchen dagegen nach Antikörpern, die der Körper nach einer Infektion zu bilden beginnt. Diese Tests greifen daher erst einige Tage nach der Infektion und sind recht unspezifisch, sie können beispielsweise durch frühere Infektionen mit CoVs verfälscht werden. Daher bedarf jeder Verdachtsfall einer Überprüfung durch einen spezifischen PCR-Test.
Behandlung
Da SARS-CoV[-1] und SARS-CoV-2 ähnliche Symptome hervorrufen, können die Erfahrungen aus der Pandemie von 2003 für die Behandlung von COVID-19 genutzt werden.
SARS-Patienten wurden isoliert und antiviral sowie symptomatisch behandelt, als Medikamente kamen Hormone, Glukokortikoide und Interferon zum Einsatz.
Für COVID-19 kam in China u.a. eine Kombination von Lopinavir als Protease-Hemmstoff, der auch für HIV-Infektionen eingesetzt wird, in Kombination mit Ritonavir als Verstärker zum Einsatz. Die Kombination hat deutliche Anti-Coronavirus-Aktivität in vitro, der klinische Effekt ist noch festzustellen.
Bei der SARS-Pandemie 2003 wurde in Kanada erstmals Interferon eingesetzt – ursprünglich entwickelt zur Behandlung chronischer Hepatitis, erwies es sich als äußerst vielversprechend.
Bei der MERS-Epidemie wurde eine Kombination von Interferon-alpha und Ribavirin in den USA erfolgreich getestet.
Seit kurzem wird das in Kuba entwickelte Medikament Heberon Alfa R in Zusammenarbeit mit China in großem Stil (und extrem preiswert im Vergleich zu US-amerikanischen und deutschen Produkten) produziert.
Auch bekannte Wirkstoffe wie Nelfinavir greifen spezifisch die Protease von CoVs an.
Das für Ebola entwickelte Nukleosidanalogon Remdesivir wird derzeit in den USA als Propharmakon getestet und intravenös verabreicht.
In China werden derzeit mehr als 30 potenzielle Wirkstoffe getestet.
Genetik der CoVs
Coronaviren haben die größten Genome aller RNA-Viren (bei SARS-CoV-2 sind es 29.903 Basen).
Innerhalb der Coronaviren formen die humanpathogenen Viren aufgrund der genetischen Ähnlichkeit eine Gruppe zusammen mit einem Fledermaus-Coronavirus (bat-SL-CoVZXC21) aus dem Südwesten Chinas.
Die genomische Ähnlichkeit von SARS-CoV[-1] und SARS-CoV-2 ist sehr groß, es gibt jedoch sechs Abschnitte, die Unterschiede aufweisen. Einer davon codiert Teile des S-Gens (s.u.), die anderen sind für zwei sogenannte orf lab-Gene zuständig (orf7b und orf 8).
Die beiden SARS-CoVs sind enger miteinander verwandt als mit MERS-CoV.
26 der 28 codierten Proteine von SARS-CoV-2 sind mit denen von SARS-CoV[-1] zu 76-99% identisch, zwei Proteine (orf8 und orf10) haben keine Homologe in SARS-CoV[-1].
Die Funktion dieser Proteine ist unbekannt und dessen Aufklärung von großer klinischer Bedeutung.
Das für die Virushülle zuständige Protein (Nukleokapsid-Protein) ist bei beiden SARS-CoVs sehr ähnlich, so dass Antikörper gegen das N-Protein von SARS-CoV[-1] wahrscheinlich auch SARS-CoV-2 erkennen werden – dies ist auch die Grundlage von Schnelltests.
Mutiert dagegen ist das Gen (S-Gen), welches für die Bildung der charakteristischen »spikes«, der Stacheln des Virus, zuständig ist.
Die spikes sind für die Verbreitung und Pathogenität des Virus entscheidend, da das Virus mit ihnen an die Wirtszellen bindet und in diese eindringt.
SARS-CoVs binden an den ACE2-Rezeptor (Angiotensin-konvertierendes Enzym 2) und hemmen gleichzeitig dessen Funktion, was u.a. zu erhöhter Gefäßpermeabilität in der Lunge führt und zentraler Teil der Pathologie von SARS und COVID-19 ist.
Im direkten Vergleich nutzt SARS-CoV-2 die ACE2-Rezeptoren effizienter als SARS-CoV[-1] des Jahres 2003, aber weniger effizient als SARS-CoV[-1] von 2002.
Die Mutation der Proteine, besonders des S-Proteins, ist verantwortlich für die beiden wichtigsten Eigenschaften des neuen humanen CoVs: eine höhere Infektionseffizienz und höhere Pathogenität als Fledermaus-SARS-CoVs, jedoch eine geringere Pathogenität als SARS-CoV[-1].
Viren mutieren ständig und während einer Pandemie werden somit auch häufig neue Varianten des Virus auftauchen. Nicht alle, genauer gesagt: nur wenige Mutationen werden neue Eigenschaften hervorrufen, aber es ist nicht auszuschließen, dass die z.T. stark variierende Letalität von COVID-19 in verschiedenen Populationen auch auf Mutationen des Erregers zurückgeht.
Fazit
COVID-19 hat, bei entsprechender medizinischer Betreuung, eine Letalität in der Größenordnung der Wintergrippe von 2017 (verursacht durch vier verschiedene Influenzaviren), allerdings zeigt der Verursacher SARS-CoV-2 eine wesentlich höhere Verbreitungseffizienz.
Dazu trägt auch die relativ lange Inkubationszeit bei, verbunden mit vielen leicht verlaufenden Erkrankungen, die oft gar nicht als COVID-19 erkannt werden (können).
Ohne eine Eindämmung der Verbreitung durch entsprechende Maßnahmen der Kontaktvermeidung, könnte im Vergleich zur Wintergrippe 2017 die fünf- bis siebenfache Anzahl von Personen (bis 60 Millionen) im gleichen oder sogar kürzeren Zeitraum infiziert werden und damit gleichzeitig ein Vielfaches von Schwererkrankten auftreten, die das Gesundheitssystem überfordern würden, d.h. für die keine adäquate medizinische Betreuung möglich wäre.
Kritische, d.h. potenziell tödliche Krankheitsverläufe sind fast ausschließlich für bestimmte Risikogruppen zu erwarten, die daher eines besonders effektiven Schutzes vor Infektion bedürfen.
Zur Beherrschung der Folgen der Ausbreitung dieses neuartigen Coronavirus ist daher eine Kombination von allgemeiner Ausbreitungseindämmung (z.B. durch hygienische Maßnahmen und Verhaltensänderungen bei Direktkontakt), Isolation der Risikogruppen, Anpassung der bekannten und Entwicklung neuer Methoden der klinischen Symptombehandlung, Entwicklung und Anwendung eines Impfstoffes und Nutzung der Immunität nach durchlaufener Infektion (mit oder ohne Symptome) vonnöten.
Letzteres scheint als einziger Punkt zu wenig Beachtung zu finden, und könnte sich kritisch bei der mittel- und langfristigen Beherrschung der Pandemie auswirken, da eine zu starke Isolation von Nicht-Risikogruppen die Ausbildung flächendeckender Immunisierung vermindert, die letztendlich der einzig wirksame Schutz der gesamten Population ist.
Langfristig wird gerade in Pflegeeinrichtungen immunisiertes Personal benötigt, die den Erreger nicht mehr übertragen können.
Auch die glücklicherweise völlige Unempfindlichkeit von Kindern für SARS-CoV-2 könnte für eine »Herdenimmunisierung« genutzt werden, jedoch sind für die Kontrolle einer solchen flächen- bzw. gruppendeckende Test vonnöten.
Es sei auch erwähnt, dass wahrscheinlich der öffentliche Personennahverkehr ein zentraler Verbreitungsfaktor von SARS-CoV-2 ist. Daher ist zum Schutz der Personen, die darauf angewiesen sind, eine deutliche Verminderung der Fahrgastdichte zu gewährleisten – auf keinen Fall dürfen Fahrtakte aus wirtschaftlichen Gründen gesenkt werden!
Die Risiken der Einführung einer allgemeinen »Mundschutzpflicht« wurden weiter oben beschrieben; sollte es dennoch zu solchen Maßnahmen kommen, sind folgende Verhaltensregeln zu beachten:
1. Wenn irgend möglich, Einweg-Produkte aus eigens dafür entwickeltem Papier oder Vliesgewebe benutzen.
Mund-Nase-Schutz (MNS) aus anderen Stoffen ist eventuell in beide Richtungen (Infektionsvermeidung für sich selbst und das Gegenüber) nutzlos, außerdem werden die meisten Stoffe durch (besonders heißes) Waschen durchlässiger für Aerosole.
Einwegmasken müssen bei einer Mundschutzpflicht kostenlos und in genügend großer Menge bereitgestellt werden, da sonst gerade die ärmeren Bevölkerungsschichten gezwungen werden, überteuerte Produkte zu kaufen oder ungeeigneten MNS zu verwenden, was das Infektionsrisiko in diesen sozialen Gruppen erhöhen könnte.
2. Der einfache Mund-Nase-Schutz ist vor dem Verlassen der Wohnung mit sauberen Händen anzuziehen und darf danach (jedenfalls nicht nachdem mit den Händen etwas berührt wurde!) weder zurechtgerückt, noch aus- und wieder angezogen werden.
3. Außerhalb der Wohnung sind auch mit MNS unbedingt die Abstandsregeln zu beachten!
4. Nach Erreichen des Ziels (entweder wieder die Wohnung nach Einkauf bzw. Spaziergang oder des Arbeitsplatzes) erst die Hände gründlich waschen (30 Sekunden mit Seife, Desinfektionsmittel ist nicht nötig), dann den MNS abnehmen und entsorgen (dringend empfohlen) oder in die Waschmaschine tun, dann noch einmal die Hände waschen.
5. Falls die Distanz von 1,5 m unterschritten werden muss, ist der MNS für den Selbstschutz nur effektiv in Verbindung mit einem Augenschutz (Schutzbrille oder Gesichtsvisier), das Gegenüber ist dabei aber nicht geschützt!
Zusammenfassend ist zum Thema Mundschutzpflicht festzustellen, das diese nicht Teil einer »Exitstrategie« sein darf, sondern nur in Verbindung mit den bisherigen Maßnahmen und Einhaltung strikter Regeln (s. oben) hilfreich sein könnte oder zumindest keine negativen Auswirkungen haben wird.
Ständig aktualisierte Informationen:
Robert-Koch-Institut 2020:
SARS-CoV-2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19), https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
Aktuelle COVID-19-Fallzahlen für Deutschland, https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
Johns-Hopkins-Universität:
2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE, https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
Häufige Abkürzungen:
2019-nCoV ursprünglicher Name von →SARS-CoV-2
CoV coronavirus (Coronavirus)
COVID-19 coronavirus disease 2019 (Coronaviruskrankheit-2019) verursacht von →SARS-CoV-2
MERS Middle East respiratory syndrome (Nahost-Atemwegssyndrom)
MERS-CoV humanes CoV als Verursacher von →MERS
SARS Severe Acute Respiratory Syndrome (schweres akutes respiratorisches Syndrom = akutes Atemwegssyndrom)
SARS-CoV[-1] humanes CoV mit Krankheitsausbruch im Jahre 2002
SARS-CoV-2 humanes CoV entdeckt 2019, offiziell am 11. Februar 2020 benannt
https://www.jungewelt.de/artikel/377249.fakten-gegen-panikmache-kleines-corona-kompendium.html
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Interessierte an einer neuen Handelspolitik,
wir hoffen, dass Sie gut ins neue Jahr gekommen sind und wünschen Ihnen alles Gute für 2020.
Wir hoffen auch, dass Sie in diesem Jahr erneut voller Energie mit uns für einen gerechten Welthandel streiten werden – zu tun gibt es genug! Bereits am Samstag nächster Woche werden wir uns an der bundesweiten Großdemonstration „Wir haben es satt!“ beteiligen. Im gemeinsamen handelspolitischen Block fordern wir, ein Veto gegen das EU-Mercosur-Handelsabkommen einzulegen, das dramatische Folgen für das Klima und die bäuerliche Landwirtschaft dies- und jenseits des Atlantiks hätte. Sind Sie am 18. Januar in Berlin mit dabei?
Alle Informationen zur „Wir haben es satt!“-Demonstration sowie zu weiteren Themen aus der Welt der Handels- und Investitionspolitik erfahren Sie in diesem Newsletter.
 + + + 2020 gemeinsam gegen das EU-Mercosur-Handelsabkommen + + +
+ + + 2020 gemeinsam gegen das EU-Mercosur-Handelsabkommen + + +
2020 stehen wichtige Entscheidungen an, unter anderem soll das Handelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten abgeschlossen werden: Nach der juristischen Prüfung, Ergänzung der noch fehlenden Textteile und Übersetzung in alle EU-Amtssprachen könnte es im zweiten Halbjahr dem EU-Ministerrat vorgelegt werden. Ein Inkrafttreten des EU-Mercosur-Abkommens wollen wir verhindern und fordern von der Bundesregierung, ein Veto im Rat einzulegen! Denn das Abkommen verfestigt ein Landwirtschaftsmodell, das auf Monokulturen und massiven Pestizideinsatz setzt, und hat dramatische Folgen für Umwelt und Gesundheit der Menschen vor Ort. Es wird den ruinösen Preiskampf in der globalen Landwirtschaft noch weiter verschärfen, die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes beschleunigen und den Klimawandel weiter anheizen.
Die neue österreichische Regierung hat sich bereits gegen das EU-Mercosur-Abkommen positioniert und im Regierungsübereinkommen ein klares Nein verankert. Schon im letzten Jahr positionierten sich Frankreich, Irland, und Luxemburg gegen das Abkommen in der aktuellen Form. Und auch im EU-Parlament gibt es heftigen Gegenwind: Mitte Dezember diskutierten die Abgeordneten über die Vereinbarkeit des Abkommens mit den Klimaschutz-Zielen – und kamen zu folgendem Ergebnis, wie Top Agrar berichtete: „Die anhaltende Vernichtung von Regenwäldern für den Anbau von Soja und Rinderzucht im Amazonasbecken, sei weder mit den Nachhaltigkeitszielen des Pariser Klimaabkommens noch mit dem Green Deal der von der Leyen-Kommission vereinbar. Dies war der Grundtenor der eineinhalbstündigen Aussprache im EU-Parlament am Mittwochnachmittag in Straßburg.“
Die Bundesregierung hingegen hält unbeirrt an ihrer Befürwortung des Abkommens fest und streitet alle negativen Auswirkungen des Abkommens ab, was sich beispielsweise in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag vom November zeigte. Daher lasst uns gemeinsam Druck machen und unseren Protest auf die Straße tragen!
Wir rufen dazu auf, bei der „Wir haben es satt!“-Demonstration am 18. Januar in Berlin teilzunehmen. Gemeinsam mit Attac, NaturFreunden und vielen weiteren organisieren wir einen handelspolitischen Demo-Block.
Statt blinder Marktöffnungen und Handelsabkommen im Interesse von Konzernen fordern wir eine gerechte Handelspolitik, die dem Klima-, Umwelt- und Verbraucherschutz dient und die bäuerliche und nachhaltige Landwirtschaft fördert.
Aufruf zum Handels-Block unter https://www.wir-haben-es-satt.de/informieren/aufruf/handelsblock/
Zum Weiterlesen: Sieben Gründe gegen das EU-Mercosur-Abkommen
In den kommenden Wochen und Monaten wollen wir unsere Kritik am EU-Mercosur-Abkommen bündeln, uns mit weiteren zivilgesellschaftlichen Akteuren vernetzen und Aktivitäten planen. Gemeinsam mit weiteren Organisationen und Verbänden veranstalten wir daher im Februar ein zivilgesellschaftliches Ratschlags-Treffen zum EU-Mercosur-Abkommen in Berlin.
+ + + 2020 gemeinsam gegen CETA + + +
2020 könnte auch das entscheidende Jahr sein, um das EU-Kanada-Abkommen CETA zu stoppen! In den Niederlanden regt sich derzeit parlamentarischer Widerstand gegen das Abkommen – gut möglich, dass es bei den bevorstehenden Abstimmungen in der ersten oder zweiten Kammer scheitern wird.
In Deutschland muss das Bundesverfassungsgericht noch über eine Verfassungsbeschwerde entscheiden, die Campact, Foodwatch und Mehr Demokratie mit Unterstützung von über 125.000 Menschen eingereicht haben. Die Beschwerde richtet sich gegen die durch CETA geschaffenen Ausschüsse, gegen die Sonderklagerechte für Konzerne und gegen einige weitere Aspekte des Abkommens. Auch die Partei Die Linke hat vor dem Bundesverfassungsgericht gegen CETA geklagt, auch hier steht eine Entscheidung noch aus. Sollte das Bundesverfassungsgericht keine Bedenken gegen CETA haben, könnte die Große Koalition auch hierzulande ein Ratifizierungsgesetz auf den Weg bringen. Dann wird es in erster Linie darauf ankommen, dass Die Linke sowie Bündnis90/Die Grünen weiterhin an ihrem Nein zum Abkommen festhalten. Im Bundesrat verfügen die Landesregierungen mit grüner Regierungsbeteiligung aktuell über 41 von 69 Stimmen, damit können sie das Abkommen dort stoppen.
Doch auch bei der SPD ist möglicherweise noch nicht alles entschieden. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans stehen CETA betont kritisch gegenüber, wie sie uns vor ihrer Wahl zum Parteivorsitz mitteilten. Insbesondere wegen der enthaltenen Sonderklagerechte für Investoren bewerten sie das Abkommen als „unzureichend“ und fordern ihre Partei zu einer weiteren Befassung mit dem Thema auf. Wir hoffen, dass diesen Aussagen Taten folgen werden!
+ + + 2020 gemeinsam gegen Sonderklagerechte für Konzerne! Verleihung der „Goldenen Klobürste“ an Vattenfall und Uniper + + +
Vor knapp einem Jahr, im Januar 2019, starteten wir gemeinsam mit über 200 europäischen Organisationen, Gewerkschaften und sozialen Bewegungen die Kampagne „Menschenrechte schützen – Konzernklagen stoppen!“. Damit setzen wir uns für ein Ende der Sonderklagerechte ein, welche im Rahmen von Handels- und Investitionsschutzabkommen an internationale Investoren verliehen werden. Zudem fordern wir verbindliche globale Regeln, um Konzerne für Verstöße gegen Menschenrechte und Umweltschutz zur Rechenschaft zu ziehen.
Weit über 600.000 Menschen haben seitdem schon für unsere Forderungen unterschrieben – Sie auch? Wir bitten Sie darum, die Petition zu unterzeichnen und den Link an Freund*innen, Verwandte und weitere Interessierte weiterzuleiten: www.gerechter-welthandel.org/menschenrechte-schuetzen-konzernklagen-stoppen. Ende Januar wollen wir die Unterschriften an das Wirtschaftsministerium übergeben. Unsere Kolleg*innen in Brüssel kümmern sich darum, dass auch die EU-Kommission unsere Unterschriften persönlich entgegen nimmt.
Einige der an der Kampagne beteiligten Organisationen haben den Negativpreis der „Goldenen Klobürste“ aus der Taufe gehoben. Für den Preis nominiert wurden Unternehmen, die sich durch besonders schlechtes Verhalten gegenüber der Bevölkerung, dem Klima- oder Umweltschutz ausgezeichnet haben. In Deutschland wollen wir die „Goldene Klobürste“ an die Energiekonzerne Vattenfall und Uniper verleihen, die sich durch die Anrufung von internationalen Schiedsgerichten gegen den Umwelt- und Klimaschutz stellen und die demokratische Energiepolitik torpedieren.
+ + + Veröffentlichungen + + +
Der globale Emissionstransfer: Warum die EU-Klimabilanz nicht die handelspolitische Wahrheit sagt
Die EU-Bilanz der Treibhausgasemissionen ist erheblich geschönt. Denn unberücksichtigt bleiben die riesigen Nettoimporte von Emissionen. Würden die dreckigen Lieferketten europäischer Konzerne offiziell bilanziert, müssten die EU-Reduktionsziele weit höher ausfallen.
https://thomas-fritz.org/default/der-globale-emissionstransfer
+ + + Termine + + +
Klimakiller Freihandel: Was das EU-Mercosur Abkommen mit Klimagerechtigkeit zu tun hat
13. Januar 2020, 18:30-20:30, Berlin
Fleisch gegen Autos, auf diese Formel wird das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den südamerikanischen Mercosur Ländern (Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay) oft heruntergebrochen. Doch auch darüber hinaus behindert das Abkommen den Kampf für Klimagerechtigkeit auf vielfältige Weise. In dieser Veranstaltung wollen wir anhand von zwei kurzen Vorträgen das Handelsabkommen der EU mit dem Mercosur genauer unter die Lupe nehmen und diskutieren, wie Handelsabkommen einer gerechten Klimapolitik im Wege stehen. Zudem wollen wir sehen ob und wo es Anknüpfungspunkte für eine gemeinsame Arbeit der Handels- und Klimabewegung und Möglichkeiten zum Handeln gegen das Abkommen gibt. Diese Veranstaltung richtet sich vor allem an Aktivistis aus der vielfältigen Klimabewegung, aber auch alle anderen interessierten Menschen sind herzlich willkommen!
Referentinnen: Camila de Abreu (Aktivistin der Brasilien Initiative in Berlin und des RefrACTa Coletivo Brasil-Berlin), Bettina Müller (PowerShift)
Veranstaltet von Attac Berlin, Extinction Rebellion Berlin, und PowerShift e.V.
Alle Infos im Facebook-Event: www.facebook.com/events/434737744136844/
„Wir haben es satt!“-Demonstration: Agrarwende anpacken, Klima schützen!
18. Januar 2020, 12 Uhr, Berlin
Alle Informationen unter www.wir-haben-es-satt.de
Aufruf zum handelspolitischen Block: www.wir-haben-es-satt.de/handel
Protestaktion gegen Konzernklagen und Preisverleihung der „Goldenen Klobürste“ an Vattenfall und Uniper
21. Januar 2020, 13-15 Uhr, Berlin
Eine Aktion im Rahmen der Kampagne „Menschenrechte schützen – Konzernklagen stoppen!“
Weitere Infos in Kürze unter www.gerechter-welthandel.org
Zivilgesellschaftliches Ratschlags-Treffen zum EU-Mercosur-Abkommen: Gerechter Welthandel statt „Fleisch für Autos“-Deals!
10. Februar 2020, 10-16 Uhr, Berlin
Veranstaltet von: AbL, Attac, Brot für die Welt, BUND, Bündnis für gentechnikfreie Landwirtschaft Niedersachsen/Bremen/Hamburg, Forum Umwelt und Entwicklung, IG Nachbau, Greenpeace, Misereor, NaturFreunde, Netzwerk Gerechter Welthandel, PowerShift
Alle Informationen, Programm sowie Anmeldeformular unter https://www.gerechter-welthandel.org/eu-mercosur-treffen2020/
Sie wollen noch mehr Informationen zur Handelspolitik? Dann besuchen Sie unsere Webseite www.gerechter-welthandel.org, unsere Facebook-Seite www.facebook.com/netzwerkgerechterwelthandel oder folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/NetzWelthandel.
Der nächste Newsletter erscheint in ca. 4-6 Wochen.
Impressum:
Forum Umwelt und Entwicklung, Marienstraße 19-20 - 10117 Berlin