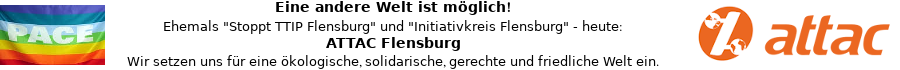Die Politikwissenschaftlerin Birgit Mahnkopf forscht zur Krux des Wachstums und zur ökosozialen Gerechtigkeit. Im Gespräch erinnert sie daran, dass wir der Krise ins Auge schauen müssen, und dies möglichst sofort. Die Kraft für eine radikale Umwälzung der Verhältnisse können wir heute nicht aus dem tröstlichen Versprechen einer wunderbaren, glücklichen Zukunft beziehen. Nein, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es gilt, das Schlimmste zu verhindern, und das muss als Antriebskraft genügen.

Interview: Raul Zelik in der WOZ Nr. 28/2021 vom 15.07.2021
WOZ: Frau Mahnkopf, Corona hat die Bedrohung durch den Klimawandel in den Hintergrund rücken lassen. Sehen Sie Parallelen zwischen der Pandemiebekämpfung und der Art und Weise, wie man gegen den Klimawandel vorgeht?
Birgit Mahnkopf: Die Pandemie wurde kurzzeitig als Zäsur erachtet, die alles ändern könnte. Und es gab auch einige Änderungen: eine Ermächtigung staatlicher Organe, die allerdings nicht besonders erfolgreich war, weil in unserer Gesellschaft die individuellen Freiheitsrechte über vieles andere gestellt werden. Im Hinblick auf die ökologische Katastrophe sehe ich eine derartige Entschiedenheit überhaupt nicht. Was gegenwärtig in den reichen Industrieländern eingeleitet wird, ist im besten Fall Augenwischerei.
Allerdings beweist die Pandemie, dass Marktgesellschaften kaum in der Lage sind, grundlegende Probleme gemeinsam zu bearbeiten. Es wird in erster Linie über die Präferenzen von Interessengruppen gesprochen.
Das ist wohl wahr. Obwohl wir regelmässig das Versagen der Märkte erleben, wird diese Maschinerie, die Karl Polanyi als «Satansmühle» bezeichnet hat, nicht hinterfragt. Das ist in der Pandemiebekämpfung nicht anders. Es gibt zwar staatliche Einschränkungen der Freiheitsrechte, aber was die Impfstoffproduktion angeht, setzt man allein auf das Prinzip der Marktanreize. Der Ruf nach staatlichem Handeln ist zwar lauter geworden, aber damit sind keine Eingriffe in die Eigentumsrechte gemeint.
In der Klimapolitik, wie sie quer durch alle Parteien, aber vor allem auch von den Grünen vertreten wird, zeigt sich das ebenfalls sehr deutlich. Nehmen wir ein vergleichsweise einfaches Problem, den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor: Anstatt klare Vorgaben zu machen, wird der Kauf eines Elektroautos mit einer Prämie von 9000 Euro belohnt, doch niemand verteilt kostenlos Fahrräder. Von einer Ermächtigung der öffentlichen Hand gegenüber den Märkten kann also keine Rede sein.
Sie sind in den letzten Jahren pessimistischer geworden, was die Frage angeht, ob sich sozialökologische Veränderungen durchsetzen lassen. Was ist denn das grösste Hindernis?
Das Junktim von Kapitalismus und Demokratie hat gut funktioniert, solange es mit unbegrenztem Wachstum einherging. Wenn heute von «ökologischer Wende» gesprochen wird, geht es darum, den Kapitalismus grüner zu machen. Nötig wäre aber eine Veränderung der Gesellschaftsform. Die gesellschaftliche Form des Industriekapitalismus ist, das lässt sich bei Marx nachlesen, die einer Warengesellschaft, ausgerichtet auf unendliche Akkumulation von Kapital. Das Kapital aber ist strukturell ignorant gegenüber den Menschen wie gegenüber der Natur. Was sich nicht mit Geld und Technik verändern lässt, unterbleibt.
Was ist mit der viel beschworenen «Klimaneutralität»?
Wer von «Klimaneutralität» schwadroniert, meint eigentlich nur: Wir setzen ein wenig mehr als bisher auf erneuerbare anstelle von fossilen Energieträgern und sichern uns – koste es, was es wolle – den Zugriff auf die dafür benötigten nicht erneuerbaren Rohstoffe, zuvorderst Metalle, Land und Wasser. Als «realistisch» und «durchsetzbar» gilt, was am bewährten «Geschäftsmodell» der OECD-Welt nichts Wesentliches ändert. Wir wollen weiter so leben wie bisher und scheren uns wenig darum, was dies für Menschen und Ökosysteme ausserhalb unseres Horizonts bedeutet. Insofern sind wir keinen Schritt weiter als vor zwanzig oder dreissig Jahren.
In den Umweltbewegungen werden ja meistens die Konsumerwartungen der vielen thematisiert. Aber sind die Kapitalinteressen der wenigen nicht viel entscheidender?
Diese beiden Aspekte lassen sich nicht voneinander trennen. Wir leben in einer Warengesellschaft, in der nicht nach essenziellen Bedürfnissen und Notwendigkeiten, sondern allein danach gefragt wird, wie eine hergestellte Ware abgesetzt wird. Profite müssen generiert und reinvestiert werden. Die KonsumentInnen sind ein elementarer Bestandteil dieses Systems, und «consumere» hat, daran sei hier erinnert, im Lateinischen auch die Bedeutung «zerstören». Etwas wird aufgebraucht. Das ist im Kapitalismus unverzichtbar – ohne Konsum weder Profit noch Produktion. Es kann also keine Rede davon sein, dass Konsuminteressen schlimmer oder weniger schlimm seien als Profitinteressen. Die Ware hat diese beiden Seiten. Wenn sie nicht konsumiert wird, erzeugt sie keinen Profit. Die radikale Alternative – weniger von allem – stellt sowohl für die KapitaleignerInnen als auch für die KonsumentInnen eine Bedrohung dar. Wir haben es also mit einer problematischen Liaison zwischen den ProfiteurInnen dieser Gesellschaftsformation und denjenigen zu tun, die eigentlich ein Interesse an Veränderungen haben müssten.
Es gibt seit den 1940er Jahren eine technologiekritische Debatte. In den letzten Jahren behaupten neue linke Strömungen, etwa der Akzelerationismus, dass wir offensiv auf technische Lösungen setzen sollten. Sie hingegen verweisen in Ihren Texten mit Günther Anders, dem ersten Ehemann von Hannah Arendt, darauf, dass zerstörerische Technologien, die einmal in der Welt sind, auch eingesetzt werden. Warum ist Technik eher ein Problem als Teil der Lösung?
Technik kann natürlich Teil der Lösung sein. Werkzeuge wie ein Hammer lassen sich bekanntermassen zu sehr unterschiedlichen Zwecken einsetzen. Aber Technologien sind ja nicht dasselbe wie Techniken und besitzen oft ein Eigenleben. Ihre Wirkung geht zumeist über unsere Fähigkeit zur Kontrolle hinaus. Seit der Aufklärung gilt, dass, so Günther Anders, alles, was technisch möglich ist, auch gemacht wird. Es gibt keine wirksame Bremse. Genau die brauchen wir aber: eine gesellschaftliche Debatte darüber, welche Technologie wir wollen und welche nicht. Faktisch passiert das Gegenteil: Die von uns erzeugte Klimakatastrophe soll mit absehbar katastrophenträchtigen Techniken des Geoengineering eingedämmt werden. Es wird nicht gefragt, was gesellschaftlich getan werden müsste, sondern es wird entwickelt, was technisch möglich ist. Wenn sich ein Markt dafür auftut, kommt die neue Technologie auch zum Einsatz, allen frühen Warnungen zum Trotz.
Sie haben sich zuletzt viel mit der Digitalisierung beschäftigt und betonen, dass die Überwachung des Einzelnen nicht das einzige Problem sei. Mindestens ebenso dramatisch seien die ökologischen Verheerungen, die die Digitalisierung nach sich ziehe.
Ja, die Datenströme verschlingen Unmengen an Energie und Ressourcen. Als EndnutzerInnen interessiert uns der Energieverbrauch der Datenzentren nicht, ein einziges verbraucht so viel Energie wie die 350 000 BewohnerInnen des Berliner Bezirks Schöneberg-Tempelhof zusammen. Dazu kommen die Rohstoffe, die für die digitalen Infrastrukturen benötigt werden. Der Begriff der Cloud suggeriert, die Daten würden durch den Himmel fliegen; aber tatsächlich bewegen sie sich ganz bodenständig durch Kupfer- und Glasfaserkabel, brauchen Satelliten im All und Trägermetalle. Die dafür nötigen Rohstoffe aber sind nicht nur ökonomisch, sondern auch im physischen und vor allem im geopolitischen Sinne knapp. Denn sie werden nur in sehr wenigen Ländern gefördert, und ihre ökologisch desaströse wie gesundheitsschädliche Produktion und Weiterverarbeitung konzentriert sich ebenfalls auf nur wenige Länder. Daher werden die geopolitischen Konflikte um diese Rohstoffe nicht geringer sein als die um das Erdöl.
In der ersten grossen Umweltbewegung der 1970er und 1980er Jahre war schon einmal viel von «Ökosozialismus» die Rede. Was ist von diesem Begriff heute noch aktuell?
Auf den Begriff kommt es vermutlich weniger an. Zumindest in Europa wissen wohl die meisten Menschen, dass etwas und was grundlegend geändert werden müsste, wenn tatsächlich eine halbwegs nachhaltige Produktions-, Verkehrs- und Lebensweise angestrebt würde. Wie der wünschenswerte Zustand benannt werden wird, das kümmert mich derzeit weniger. Unstrittig aber dürfte sein, dass Pläne und viele Verhandlungen an die Stelle des Marktes treten müssten.
Also Planwirtschaft?
Es stimmt natürlich, dass es in der Vergangenheit fehlgeleitete Planwirtschaften gab. Trotzdem sind Pläne notwendig, wenn Gesellschaften mit physischem Mangel und mit geopolitischer Knappheit konfrontiert sind und wenn es darum geht, sozial gerecht und friedlich mit diesen unvermeidlichen Konstellationen umzugehen. Dann braucht man zwangsläufig Rationierung. Ich verwende diesen Begriff, bei dem alle zusammenzucken, ganz bewusst, um deutlich zu machen: Wenn Wasser, fruchtbares Land und viele Metalle zu knappen Ressourcen werden, dann muss es Verhandlungen und global gerechte Entscheidungen darüber geben, wofür sie verwendet werden sollen.
Für Golfplätze oder für Trinkwasser …
Ja, oder für die Produktion von Wasserstoff als Energieträger, denn diese Technologie kann die Wasserknappheit vielerorts dramatisch verschärfen. Für diese Entscheidungen benötigen wir ein faires System des Interessenausgleichs. «Managed austerity» – eine gesteuerte Sparsamkeit in globalem Massstab. Unter den heutigen Bedingungen des Weltmarkts bestimmen die zahlungskräftigen Abnehmer, während alle anderen sehen können, wo sie bleiben.
Was können wir denn von der Zukunft erwarten?
Bevor es eine ökosozialistische Perspektive geben kann, werden wohl Chaos, Konflikte und gewalttätige Auseinandersetzungen zunehmen. Wichtiger als der Streit darüber, in welchem Mischverhältnis Staat und Gesellschaft, Plan und Markt in Zukunft stehen werden, scheint mir ein realistischer Blick in die absehbare Zukunft. Die Linke erweckt oft den Eindruck, als müsste der dritte Schritt vor dem ersten getan werden. Der erste Schritt bestünde aber darin, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass wir der Krise ins Auge schauen müssen, und dies möglichst sofort. Die Kraft für eine radikale Umwälzung der Verhältnisse können wir heute nicht aus dem tröstlichen Versprechen einer wunderbaren, glücklichen Zukunft beziehen. Nein, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es gilt, das Schlimmste zu verhindern, und das muss als Antriebskraft genügen. Wir hätten die Aufgabe, heute Institutionen zu schaffen, die mit dieser Krise anders als nur zerstörerisch umgehen können.